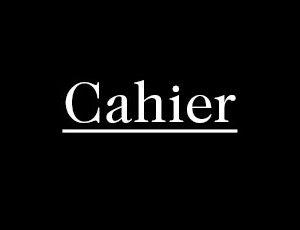Avatar und Atavismus
Archaik und Anatomie: Erkenntnissuche im Deformierten in der Kunsthalle Düsseldorf (bis 8.11.15). Von Magdalena Kröner.
Der fragmentierte Körper als künstlerisches Thema, das über die Darstellung des Anatomischen hinausweist, ist ein relativ junges Phänomen, und wenn man ein Datum für dessen Beginn sucht, wäre es wohl das Jahr 1917. In diesem Jahr formulierte Sigmund Freud erstmals das Diktum vom „zerstückelten Körper“ als Modus einer traumatisierten Selbsterfahrung vor dem Hintergrund des 1. Weltkrieges und der Krise der Moderne. Mensch, Leib und Geist als Ganzes zu denken schien fortan nicht mehr möglich. Immer wieder griffen Künstler das Thema auf: Expressionismus und Surrealismus schufen Körperbilder, die für die von Freud formulierten Wahrnehmung drastische Bilder fanden. Danach kam erst einmal lange nichts, was den Körper betraf. Die Kunst wurde erst abstrakt, dann minimalistisch, dann konzeptlastig.
Doch spätestens mit der postmodernen Wende der 80er Jahre wurden Antlitz und Körper plötzlich wieder zu Themen junger Kunst. In Düsseldorf versucht nun eine breit angelegte, von Veit Loers gemeinsam mit Gregor Jansen und Pia Witzmann kuratierte Gruppenschau zu zeigen, welchen Ideen die Künstler ab den 80er Jahren folgten, die eine neue, gebrochene Figuration ins Zentrum ihrer Arbeit rückten. Die Ausstellung „Avatar und Atavismus“ nimmt sich den ganzen, der Kunsthalle zur Verfügung stehenden Raum, um das Thema aufzufächern, und tut dies bis in weniger bekannte Verästelungen hinein, die man so dicht beieinander lange nicht gesehen hat. Neben bekannten Schaustücken wie Bruce Naumans „Double Poke in the Eye II“ (1985), Rosemarie Trockels Wollmützen (1986), Mike Kelleys unheimlichen Stofftieren (1991) oder Sarah Lucas’ mechanischem „Wanker“ (1999) gibt es weniger bekannte Werke der italienischen Transavanguardia und von einigen schrägen Helden der Mühlheimer Freiheit zu sehen. Francesco Clemente malt im Jahr 1982 einen bauchlastigen „Torso come principio“ ganz ohne Kopf , Jiří Georg Dokoupil malt 1984 für seine Serie „Therapeutische Bilder“ ein von manischer Kleinteiligkeit geprägtes Riesengemälde mit zahllosen Gesichtern und Fratzen darin und einen „schönen Konsul“ auf rotem Samt, mit einem von Eitelkeit verzerrten Antlitz und deutlichen Anklängen an den Primitivismus.
Günther Förgs archaisch wirkende 12 „Masken“ aus dem Jahr 1990 können für die Ausstellung als eine Art Schlüsselwerk gelesen werden: aufgespießt auf Moniereisen wie Schrumpfköpfe im Naturkundemuseum, ist jeder ein bißchen anders und mancher kaum als Antlitz zu erkennen. Hier zeigt sich Identität als vorübergehende Inkarnation; als zufällige Formgebung, der ihr naher Verfall bereits eingeschrieben ist. Förgs „Masken“ verweisen, wie viele Arbeiten der Schau, auf archaische und primitive Symbolik, die die Kunstgeschichte des Westens immer wieder für neue Impulse heranzog.
In den 80er Jahren schien die plötzliche Rückkehr der Fratzen, der abgetrennten Gliedmaßen und deformierten, dysfunktionalen Körper vor allem ein direkter Widerhall postmoderner Theoriebildung zu sein: Baudrillards Idee des Realen als „Simulacrum“, Lacans Überlegungen zur frühkindlichen Entwicklung und dem „Spiegelstadium“, die Freuds Begriff des zerstückelten Körpers wiederaufnahmen, dazu die aufkommende Gendertheorie, die die biologische Dualität der Geschlechter grundlegend in Frage stellte. Gesamtgesellschaftlich schufen die sich abzeichnende, kapitalistische Beschleunigung, eine erneuerte atomare Bedrohung und breit angelegte Überwachung einen Kontext, in welchem der Körper plötzlich wieder eine größere Relevanz zu besitzen schien, als die von jeglicher Irritation bereinigten, weißen Räume des Minimal.
Der Körper als trügerisches Spiegelbild der eigenen Identität; das Verformte und Beschädigte des Ich, der schwer zu fassende, flimmernde Umriss der Psyche: Die Körperfragmente und Dysplasien, die man in diesen Jahren zu sehen bekam, schienen genau die richtigen Formen zu besitzen, an denen sich eine grundlegende gesellschaftliche Verunsicherung ablesen ließ.
Dies zeigen die stärksten Bilder der Schau: das mehrfach gebrochene und aus sieben Einzelbildern zusammengesetzte „Martin schaut durchs Schlüsselloch“ von Martin Kippenberger aus dem Jahr 1983 ebenso wie Walter Dahns „Die Schleuder“ von 1982, Georg Herolds „Nachweis höherer Intelligenz (Neanderthaler/Einstein)“ von 1984.
Auch die „Outsider Art“ ist mit markanten Beispielen vertreten und fügt der Schau einen weiteren möglichen Blickwinkel hinzu, aus dem sich zusätzliche strukturelle Fragen ergeben könnten: die Frage danach etwa, wer hier wohl näher dran am Thema sei – der „Insider“, also der akademisch gebildete Künstler mit einer professionalisierten Kunstproduktion oder der sogenannte „Outsider“, der aus einer wie auch immer gearteten, inneren Notwendgkeit heraus arbeitet und ob und wie sich beide gegenseitig anregen können. Ein wichtiger Akzent in dieser an Eindrücken überreichen Ausstellung. Hier fallen vor allem Alfred Stiefs Chimären auf, aus grober Kordel gehäkelte Agenten eines geheimen Beschwörungsrituals, sowie Karl Burkhards Bleistiftzeichnungen, die an Giacometti erinnern mögen.
Beim Sprung in die Gegenwart macht die Schau ihr Thema dann allerdings musealer als notwendig, mit Arbeiten, die zwar stark sind, die man aber einmal zu oft gesehen hat: Thomas Zipps bleiäugige „Stellvertreter“ in schwarzen Spitzmützen oder Dana Schutz’ erfundene Portraits, die immer so wirken, als zeigten sie jemanden, den man kennt. Hingucker ist das bereits 2005 in Zusammenarbeit entstandene, ödipal durchwirkte, rosafarbene Spielzimmer „Mor“ (Dänisch für Mutter) von Jonathan Meese und Tal R, das hier in einer Neuauflage zu sehen ist. Die grelle Kammer ist voll des üblichen Talmi, doch die übergroßen Matroschka-Figuren und bleichen Kürbisse von Tal R, sein Video „Mor“ und als Soundtrack Ibsens „Peer Gynt Suite verleihen dem angejahrten Zirkus-Chic Meeses wirkungsvolle psychologische Aufladung.
Doch hätte man sich aktuelle Aussagen und Bilder gewünscht, die jetzt gerade auf anderen Wegen entstehen; anders aussehen und etwas anderes formulieren als diejenigen Bilder zu Avataren und Atavismen aus den letzten fünfzehn Jahren. Künstler wie Ed Atkins, Juliana Huxtable oder Simon Denny, um nur ein paar zu nennen, die den existierenden Bilden von Körper und Geist eindringliche neue hinzufügen.
Zu entdecken sind allerdings die sehr anschaulichen, aber nie in den Kitsch driftenden Kinderfigurinen der jungen Tschechin Eva Kot’átková, die bereits mit ihren Arbeiten in Massimiliano Gionis „Enzyklopädischem Palast“ auf der Venedig-Biennale vor zwei Jahren im Gedächtnis blieb. Sie zeigt das domestizierte Kind, eingehegt von Erziehung und Kultur, eingesponnen in drastische Geschirre. Die Künstlerin zeigt das vorzeitige Ende des Wilden, welches doch die Kindheit eigentlich auszeichnet. Ein schwarzer, verglaster Kasten entspinnt in zahllosen, säuberlich ausgeschnittenen Bild- und Textfragmenten den Dialog eines Kindes mit einem Arzt. „Image Atlas of Johan, a boy who cut a library of the clinic into pieces“ (2014) veranschaulicht die Deutungsmuster der Psychoanalyse; den sachlichen Blick auf das Kind als analytisches Objekt, der Dinge zu kategorisieren sucht, die vielleicht gar nicht benannt werden wollen.
Die Ausstellung „Avatar und Atavismus“ zeigt den „zerstückelten Körper“, der eigentlich ein“zerstückeltes Ich“ ist, als grundlegende Disposition, die von der Moderne bis in die unmittelbare Gegenwart reicht, und durch nichts Künftiges mehr zu heilen sein wird.