
Haints and saints don’t bother me – I’m not alone you see
Oliver Tepel über „Es war einmal in Amerika“ im Wallraf-Richartz-Museum, Köln, bis 24.3.
Ein umzäuntes, weisses Holzhaus im Stil des mittleren 19. Jahrhunderts, etwas einsam auf dem kleinen Grashügel im kühlen Licht des Nachmittags. Edward Hoppers „Hodgkin’s House“, umrahmt vor einem sich sanft entsagenden, melancholischen Altrosa. Darauf, in großen Lettern: „Es war einmal in Amerika“. Dieses, im Stadtbild Kölns gerade recht prominente Plakatmotiv der aktuellen Ausstellung des Wallraf-Richartz-Museums zur Kunstgeschichte der USA, erinnert mich stets an die Rückseite des Covers der LP „Music from Big Pink„. Selbst wo dort das weit schmucklosere Haus rosafarben und der Hintergrund in weiß gehalten ist, funktioniert die Assoziation unmittelbar. Das derart gestaltete Album von The Band begründete für viele, was heute „Americana“ genannt wird, jene teils schwärmerische, teils besinnliche Auseinandersetzung mit dem historischen und dem mythischen Amerika, in ihrer Grundthese wohl behauptend, dass diese beiden Perspektiven kaum und keinesfalls trennscharf zu unterscheiden seien. Es liegt in der Kraft der amerikanischen Verheißung, dass die Sozialgeschichte dieses Landes bis heute Millionen Menschen fasziniert und von anderen verachtet, gar gehasst wird.

Edward Hopper (1882 – 1967), Hodgkin’s House (Hodgkins Haus), 1928, Öl auf Leinwand, Privatsammlung, © Artists Rights Society (ARS), Foto: Adam Reich Photography
The Band und ihre Hörer, die Rockfans der späten 60er, erlebten erstmals, leid- und verwirrend lustvoll zugleich, den Weg zurück in ein Amerika, von dem sie meinten, sich befreit zu haben, fort vom American Way of Life ihrer Kindheit, beschämt auch von dem, was ihnen die kritischen Western-Filme der 50er über die Verbrechen an den Indianern berichteten, vom Wissen über Sklaverei und Ausbeutung. Nun erblickten die Langhaarigen in den Songs des Sohnes einer kanadischen Mohawk Indianerin, gleich seinen Bandkollegen im Stil einfacher Arbeiter des 19. Jahrhunderts beim sonntäglichen Kirchgang gekleidet, dass sie vielleicht nur eine weitere Version der Träume ihrer siedelnden Vorfahren lebten, lediglich befreit von deren Last und Entbehrungen.
Sind unsere Perspektiven heute grundlegend anders? – Dieser Frage stellt sich jene beeindruckende Ausstellung, die auf einer Etage des Wallraff-Richartz-Museums gut 300 Jahre amerikanischer Kunst präsentiert. Was man der Kunst einzelner europäischer Nationen so nicht widerfahren ließe, da ein solches Unterfangen als zu verkürzend erschien, bietet hier jedoch wirklich Anlass zum Lob, denn die letzte Welle der Beschäftigung mit Amerikanischer Kunstgeschichte ebbte in den frühen 90ern ab, es folgte Schweigen.

Anne Pollard at one hundred years of age, oil on canvas by unidentified artist, 1721, 70.7 cm x 57.7 cm, Massachusetts Historical Society
Ungelenk erscheinen die ersten Werke anonymer Maler am Ende des 17ten Jahrhunderts und dies mag ein Glücksfall sein. Zum einen versteht man in ihrem Angesicht, dass nicht das gehobene Bürgertum samt kulturellem Umfeld immigrierte, sondern Verfolgte und Außenseiter, die Perspektivlosen und Bedrohten des alten Kontinents. Das Gesicht der in der neuen Welt gealterten Anne Pollard zeigt im Bildnis eines unbekannten Meisters eine gerade noch von puritanischer Disziplin in Zaum gehaltene Melancholie, die leeren, dunklen Augen sind schwer von des Lebens Last und seinen wahrscheinlich verwirrenden Zumutungen. So als würde das Kind, welches England verlässt, immer noch die alte Ordnung suchen. Zugleich ist da der Stolz, sich durchgesetzt zu haben, doch hält sie die Bibel mit der Zartheit einer manieristischen Grazie. Diese seltsame, düstere Ruhe erscheint in vielen der frühen Bilder, auch in den Portraits nativer Amerikaner begleitet von skeptischem Stolz.
Abbildungen des Privaten waren nach der bilderfeindlichen Lehre vieler Puritaner der ersten Einwanderergenerationen kaum weniger als ein Götzendienst. Aber die Gesichter der Portraitierten bezeugen eine unmittelbare Kraft im Entstehen einer neuen Kultur, geboren nicht allein aus religiöser Strenge, sondern ebenso aus Aufklärung und Französischer Revolution und nicht zuletzt aus der Erfahrung einer neuen Welt. Europäer, wenngleich auch von vergleichbaren kulturellen Entwicklungen hin zu freiheitlicheren Systemen teilnehmend, empfanden diese Gesichter bei Robert Feke oder Benjamin West, ja auch noch beim in Italien und England ausgebildeten John Singleton Copley in ihrer enormen Präsenz als vordergründig. Was sie aber bezeugen, sind weniger mangelnde künstlerische Fähigkeiten, als Selbstbewusstsein, welchem der Puritanismus kaum mehr Herr wird, ihre Blicke reinszenieren den weltlichen Stolz italienischer Bürger der Renaissance. Eine Kultur des „Ich“ von deren Verheißungen auch wir unmittelbar geprägt wurden, gestaltet das amerikanische Zeitalter, seine Freiheiten und auch sein schlechtes Gewissen. Lassen sie uns dem Weg dieser Kultur weiter folgen!
Seinen Nachnamen hatte James Bowdoin II von seinen französischen Vorfahren, vertriebene Hugenotten, die über Irland nach Amerika auswanderten. Seine Sprache war längst das Englische. Doch der Bogen in der Hand des von John Smibert für europäischen Geschmack zu raumfordernd inszenierten, kindlichen James Bowdoin II, will mehr als ein Wortspiel. Der Pfeil in der anderen Hand weist nach oben. Tatsächlich wurde er ein bedeutender Politiker, Intellektueller und forschte gemeinsam mit Benjamin Franklin an der Elektrizität. Ein in Europa selten derart prononciertes, erwartungsvolles „Ich!“ blickt bereits aus den Augen des Zehnjährigen, derweil sich die Landschaft hinter dem Jungen in fast noch barocker Eintracht schlängelt und schließt.
In der Folge erleben wir, wie der in Europa eher gering geschätzten Landschaftsmalerei größte Aufmerksamkeit zuteil wird. Und diese Landschaft ist nicht verschlossen, im Gegenteil, ihr Thema, ja ihre Passion ist die Weite. Thomas Cole, der seine Jugend in England verbrachte, lebte noch keine zehn Jahre in Amerika als er den Pionier Daniel Boone portraitierte, klein, fast verloren, wenngleich hell erleuchtet vom Sonnenlicht, mit seinem Hund vor seiner Hütte am linken, unteren Rand seines Bildes. Den Rest füllt jene dramatische und offenbar endlose Natur, unbeherrschte Wildnis über deren Hügeln Licht und Wolken ein machtvolles Spektakel inszenieren. Ein Sturm oder ein Gewitter drohen. Bereits das Licht, was den Siedler trifft, hat sich seinen Weg durch eine Lücke im Wolkenmeer erschlichen, so dass es die beiden Lebewesen spotlightgleich beleuchtet. Wildnis konnte die europäische Landschaft nicht mehr bieten, noch weniger unentdecktes Land. In verschiedenen, stets hoch interessanten Variationen kündet die Amerikanische Landschaftsmalerei von der Perspektive des Entdeckers, des Pioniers. Für die frühen Puritanier war die Landschaft zugleich ein Ort der Angst und der Verheißung. In all ihrer Unwegbarkeit und Pracht schien sich tatsächlich das gelobte Land vor ihnen auszubreiten. Die Wirkkraft dieser historisch einzigartigen Erfahrung lässt sich kaum ermessen.
Bald gewinnt die Landschaftsmalerei eine eigene Dynamik, entzieht sich dabei dem Puritanischen, lobt aber tadelt auch die Urbarmachung der Wildnis, welche aber nie aus den Landschaften, ja nicht einmal aus den späteren Darstellungen der Großstadt verschwindet. Wie weit diese Dynamik führt, zeigte Thomas Coles „Die Elemente (Vertreibung – Mond und Feuer)“, auch wenn der Titel dieses Werks nicht ganz gesichert ist, so sind Bezüge zu dem im selben Jahr zuvor entstandenen Gemälde der Vertreibung aus dem Paradies, in dem Eva und Adam als kleine gehetzte Figuren in der Landschaft verschwinden, offenkundig. Hier nun sind keine Lebewesen mehr zugegen. Cole malt ein überdramatisiertes Naturschauspiel, um eine schmale, natürliche Felsbrücke herum. Ein von gleißendem Licht erfülltes Felsentor öffnet den Weg in eine friedlich ruhende Landschaft, doch mag das intensiv feurige Leuchten ebenso den Weg versperren und alle Lebewesen in eine von Vulkanausbrüchen und dem bedrohlich matten Schein des Vollmondes gezeichnete Welt verdammen.

Thomas Cole, Expulsion, Moonlight, and Fire, circa 1828, oil on canvas, 91.4 x 122 cm, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
Coles Schaffen begründete die Hudson River School, jene Gruppe amerikanischer Landschaftsmaler, deren Stil auch von Absolventen der Düsseldorfer Malerschule mitgeprägt wurde. Als 1989 die Ausstellung „Bilder aus der Neuen Welt“ das letzte Mal einen umfassenden Blick auf die amerikanische Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts bot, schrieb Otto von Simson im Katalog: „Der Blick ins Unendliche, in die Ferne, spielt in der amerikanischen Landschaftsmalerei eine Rolle, die nicht begreiflich ist, ohne das Erlebnis, welches auch das politische Denken, ja die Geschichte Amerikas entscheidend geprägt hat. F. J. Turner hat dafür den Begriff ‚Frontier’, Grenze verwendet. Grenze bedeutet hier jedoch beinahe das Gegenteil von dem, was der Europäer darunter versteht, nicht Abschluss, sondern Öffnung, nicht die Umfriedung des Bekannten und Gewohnten, sondern im Gegenteil das Geheimnis des jenseits des ‚Heimatlichen’ liegenden Unbekannten.“
30 Jahre später dominiert in den Erläuterungen der Saaltexte und auch oftmals in denen des Katalogs kritische Distanz. Die „Frontier“ erscheint nun als sentimentale Nostalgie und die Landschaften als Rechtfertigungen einer imperialistischen Ausdehnung gen Westen. Auch 1989 war Otto von Simson die politische Funktion der Landschaftsmalerei, insbesondere zur Zeit der Präsidentschaft Andrew Jacksons und seiner, den nativen Amerikanern gegenüber vertragsbrecherischen und grausamen Expansionspolitik, durchaus bewusst. Anders als heute verstand von Simson die Landschaftsmalerei aber genuin als Ausdruck eines Freiheitsbegriffs, welcher sich, weit nachhaltiger als die puritanischen Verheißungen, in die amerikanische Verfassung einschrieb. Diese Idee der Freiheit in den Landschaftsbildern zu erkennen, bietet einen Zugang zu ihrer Besonderheit. Sie vor allem als politisches Instrument oder in den Worten des Saaltexts, Abkömmling der „europäischen Idee der heroischen Landschaft“ zu fassen, verkennt jenes Besondere. So dokumentiert die textliche Einfassung der Ausstellung, vielleicht intendiert, auch einen Wandel in der Bewertung des Begriffs der Freiheit. Dies ist ihr gutes Recht, doch entsteht der Eindruck, dass Bewertung nun wieder Vorrang vor dem Versuch des Verstehens hat. Das Fremde schrumpft auch in der Folge zum allzu Vertrauten, die amerikanischen Künstler auf der Weltausstellung in Paris erscheinen im Saaltext, wie schon einst dem europäischen Kunstfreund, als altmodisch. Ihre Gründe, nicht der europäischen Moderne zu folgen oder in ihren Aneignungen, etwa denen des Impressionismus, andere Akzente als die Europäer zu wählen, sind heute wieder weniger interessant. Das Urteil vor der Differenzierung des Blicks.

Frederic Remington (1861 – 1909), The Bronco Buster (Der Zureiter), 1895, Bronze, The R.W. Norton Art Gallery, Shreveport, Louisiana
Abseits davon erweist sich die bewundernswerte Ansammlung viel zu selten gezeigter Kunst des 19. Jahrhunderts als Quell des Staunens. Wie gut, dass die Kuratoren auch die sonst kaum gezeigte Plastik mitbedachten. Frederic Remingtons „The Bronco Buster“ berichtet voll dynamischer Bewegungsenergie vom brutalen Alltag der Cowboys und will doch bis hin zum Zaumzeug aus Silberdraht jedes Detail festhalten. Und die Malerei? – George Caleb Binghams Flößer verkörpern, vor dem sehnsüchtigen Licht der Ferne, in ihren Blicken weltabgewandte Verträumtheit wie auch kühles Selbstbewusstsein. Im dunstig pastellenen „Morning in the Hudson, Haverstraw Bay“ von Sanford Robinson Gifford bändigen allein die Segel der winzig erscheinenden Boote den ansonsten völlig abstrakten Fluss der Farben, wo sie bojengleich eine Uferlinie markieren. Winzig wirken die Kolibris in Martin Johnson Heades „Cattleya Orchid and three Hummingbirds“ neben einer in ihrer Pracht nahezu erschreckenden Orchidee. Ihr Nest schafft eine Sogwirkung als Gegenpol zur aus dem Bildgrund hervorspringenden Blüte. Also doch eine Wunderwelt? Wie stark fern aller politisch, strategischer Erwägung oder religiöser Strebsamkeit die Vision der neuen Welt wirkte, vermochte kaum jemand derart intensiv zu fassen, wie der Quäker und Dekorationsmaker Edward Hicks. Er entdeckte in Amerika das „Peaceable Kingdom“, die potenzielle Verwirklichung von Jesajas als „Tierfrieden“ bekannter Vision einer diesseitigen Überwindung des Sündenfalls. Ein seltenes Motiv der christlichen Malerei (wenn, dann eher in Darstellungen der letzten Momente des Paradieses eingebettet, etwa bei Cornelis Corneliszoon van Haarlem), da es eben nicht auf das Jenseits ausgerichtet ist, sondern dem Hoffen der Quäker entspricht, dass ein inneres, göttliches Licht jedem Menschen innewohne. Arglos blicken nun Löwe und Leopard, Bär und Kuh fressen gemeinsam Heu, die Welt ist der Grausamkeit entkommen und im Hintergrund der keinesfalls akademischen Komposition, schließen Siedler und native Amerikaner Frieden. Dass im verhießenen gelobten Land die Neuankömmlinge nicht allein Gottes Günstlinge sondern auch Übeltäter sind, davon berichtet Hicks Gemälde ebenso, wie von der alles übersteigenden Vision einer friedvollen Gemeinschaft, für die um 1835 kein Europäer auch nur einen Anlass zur Hoffnung erblickt hätte. Henri Rousseaus „Le Rêve“ antizipierend, fand Hicks die intensivste, aufrichtigste und vielleicht auch anmaßendste Darstellung des amerikanischen Traums.

Sanford Robinson Gifford (1823 – 1880), Morning in the Hudson, Haverstraw Bay (Morgen am Hudson River, Haverstraw Bay), 1866, Öl auf Leinwand, Terra Foundation for American Art, Daniel J. Terra Collection, 1993.11, © Terra Foundation for American Art, Chicago / Art Resource, NY
Bald wird die Malerei bürgerlicher. Winslow Homers Croquetspielerinnen, statisch, wie zugleich um sich selbst kreisend erscheinen als eine amerikanische Antwort auf den Impressionismus, ebenso Cecilia Beaux „Sita and Sarita“, welches zugleich bezeugt, wie selbst das völlig abwesende Ich in der Kunst Amerikas immer noch präsent und detailliert dargestellt werden will. Das störrisch, neugierige Ich einer kleinen Katze kontrastiert und steigert den sinnierenden Habitus der jungen Frau. Aufsehenerregend, die ganz eigene, fast tagebuchartige Avantgarde der USA, die „Steckbrett“ Trompe l’oeil Malerei des ausgehenden 19. Jahrhunderts, Surrealismus und Fotorealismus vorwegnehmend, hier leider nur repräsentiert durch William Michael Harnetts „The old cupboard door“ und John Haberles hypnotisches „One Dollar Bill“. Wie Haberles intensiver Detailblick auf eine halb zerfetzte Dollarnote in den Werken der amerikanischen Nachkriegsmoderne widerhallt, wäre eine Ausstellung für sich wert.

Winslow Homer (1836 – 1910), A Game of Croquet (Ein Krocketspiel), 1866, Öl auf Leinwand, New Haven, Yale University Art Gallery, Bequest of Stephen Carlton Clark, B.A. 1903
Nachdem die moderne Kunst jener letzten Jahre des 19. Jahrhunderts im Saaltext noch den Anstrich einer elitären Repräsentationskunst erhält, verstummen im Weiteren die kritische Distanz und auch der Abgleich zur europäischen Kunst. Ab nun wird im Sinne des universalgültigen, rebellischen Mythos der Hochmoderne argumentiert, ob diese das Leiden der nativen Amerikaner in den Reservaten oder die rassistische Ausgrenzung thematisiert oder gar angemessen darstellt, scheint nun weniger bedeutsam. Zum Glück zeigen die ausgestellten Werke zu einem großen Teil die weitere Eigenständigkeit der US-Moderne. Nahezu unbeherrschbar, die Menge der zu zeigenden Kunst und der letztlich doch begrenzte Platz einer Sonderausstellung. So verschwanden zwei Räume zuvor bereits die zarten Abstufungen in verschiedenen schwarz und dunkelbraun Tönen von John Singer Sargents Porträt des „Asher Wertheimer“ zumindest an sonnigen Tagen im Licht des einzigen großen Fensters. Und für die Werke der in Europa wirklich noch kaum entdeckten Helen Lundeberg und Kay Sage mit ihrem, auf einzigartige Weise ins Abstrakte herüberführenden Surrealismus wird der Platz inmitten des Füllhorns an selten gezeigter Vorkriegsmoderne knapp. Als letzte Werke vor dem abschließenden Saal mit der abstrakten Kunst, hängen sie übereinander. Ein Sinnbild für alles, was unbedingt noch hätte gezeigt werden wollen und vielleicht, in Anbetracht der Sammlung des Museums Ludwig , auch auf Kosten der nun doch leidlich bekannten Pollock, Rothko, Newman, hätte gezeigt werden sollen.
Doch auch sehr beeindruckende Effekte werden kuratiert, etwa das ferne, aber wirkungsvolle Gegenüber von Robert Henris „la Reina Mora“ und der sieben Jahre später im nahezu selben Format entstandenen „Figure in Motion“, deren versachlichender Titel nicht verleugnen kann, mit welcher, geradezu verliebten Bewunderung Henri sein Model verewigte. Man sucht den Vergleich zur namentlich genannten und doch auf subtile Weise unpersönlicher erscheinenden „Reina Mora“, geht hin und her, um den Eindruck zu überprüfen. So versagt die „Figure in Motion“ auch ein wenig in ihrer Funktion als Entrée zur experimentellen Moderne – oder vielleicht doch nicht, wo weder Kirchner noch Modigliani je vergleichbare schwarze Augen glückten.

Charles Demuth (1883 – 1935), Aucassin and Nicolette (Aucassin und Nicolette), 1921, Öl auf Leinwand, Columbus Museum of Art, Ohio: Gift of Ferdinand Howald
Beeindruckend auch die Betonwildnis der Kulmination von Werken, welche die Wolkenkratzerarchitektur der Metropolen thematisieren. Gemälde von Georgia O’Keeffe, Charles Demuth, George Ault und Joseph Stella sowie John Bradley Stoors abstrakte Plastik im Art Deco Stil, in welcher die Großstadt bereits als Biotop futuristischer Wunderwesen erscheint. Doch da sind wir wieder im Amerikana, im von Historie und Mythos wechselseitig durchdrungenen Raum. Wahrscheinlich waren wir nie anderswo. Vielleicht nur weil um sie herum der Blick auf den Eingangsbereich der Ausstellung preisgegeben wird, erscheint Hugo Rebus“ stille Skulptur „Despair“ als stumme Antithese der amerikanischen Geschichte. Als untröstliches Verzagen, das Ende aller Hoffnungen. Statt der Errungenschaften nur Brutalität und Kälte. So erinnert sie an King Vidors Film „The Crowd“, jenem Portrait des Scheiterns am amerikanischen Traum.

Georgia O’Keeffe (1887 – 1986), Blue and Green Music (Musik in Grün und Blau), 1919/21, Öl auf Leinwand, The Art Institute of Chicago, Alfred Stieglitz Collection, gift of Georgia O’Keeffe, 1969.835; © Georgia O’Keeffe Museum, Foto: © bpk / The Art Institute of Chicago / Art Resource, NY
Keine Ausstellung über amerikanische Kunst hat Amerika lobzupreisen. Aber eine nur unzureichend bekannte, komplette Kunstgeschichte darzustellen und zugleich zu kritisieren und rekontextualisieren, das überfrachtet jedes Konzept, ja auch den schwersten Katalog. Kontextlos verloren erscheinen insbesondere die gezeigten Werke nativer amerikanischer Kulturen. Sie haben ihre ganz eigene Geschichte, zu deren angemessener Vermittlung bedarf es Ausstellungen wie „Auf den Spuren der Irokesen“, 2013 in der Bonner Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik. Es ist nicht mal Schuld der Amerikaner, sondern die Konsequenz eines in Europa geprägten Kunstverständnisses und so wirken diese Arbeiten instrumentalisiert, einem schlechten Gewissen Rechnung tragend, welches sich im Allgemeinen um die Geringschätzung nicht-akademischer Kunstgeschichte im europäischen Raum nur wenig schert.
Auch „in Zeiten von Transnationalismus und multikultureller Vielfalt“, von denen das Ausstellungskonzept spricht, kommen maßgebliche Impulse entsprechend kritischer Theoriebildung aus den USA und stärker als jedes europäische Land lebt die USA Mulitkulturalität. Sie bleibt, wie ihre Kunst, ein gelebtes Experiment, oft genug scheiternd, aber zum Gelingen nicht notwendigerweise den Vorgaben europäischer Weisheit unterworfen.
Letztlich ist mit Händen zu greifen, dass diese vor 1945 entstandene amerikanische Kunst nicht für die Uni und nicht alleine für den Diskurs der Intellektuellen gemacht wurde. Sie hatte gar keine Zeit dazu, musste sie doch in neuen Sprachen von einem neuen Leben in einer neuen Welt berichten und uns ihre Einblicke und Einsichten kundtun, uns staunen machen, bewegt, verzückt, verwirrt und auch zornig. Wenn ich ohne Beachtung aller Texte und Hintergedanken durch die Ausstellung gehe, so ist es das, was mir die wundervollen Werke vermitteln.
Artikelbild: John Haberle (1856 – 1933), One Dollar Bill (Ein-Dollarschein), 1890, Öl auf Leinwand, Terra Foundation for American Art, Daniel J. Terra Art Acquisition Endowment Fund 2015.4, Foto: © Terra Foundation for American Art, Chicago / Art Resource, NY





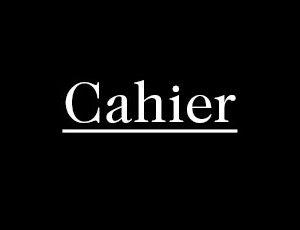


Das ist eine ausgezeichnete Ausstellungsbesprechung. Besonders der Aspekt mit der Kultur des Ichs ist sehr spannend. Wie sich diese Kultur wohl in unserer Kunstgeschichte wiederspiegelt?