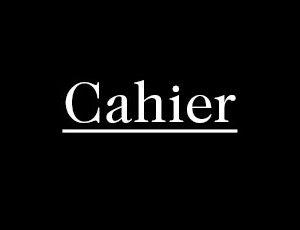Katharina Hinsberg
Oliver Tepel über Katharina Hinsberg „Linie und Schnitt“ in der Galerie Werner Klein, Köln (23.1.-27.2.16)
Die Idee, was Kunst sein könnte, zerfließt bei genauerer Betrachtung. Sie gleicht dem Schicksal einzelner Schneeflocken in der Handinnenfläche. Ändern wir die Bedingungen ein wenig, hören wir auf, zu fragen oder wähnen wir uns im Besitz einer Antwort, bekommen wir unterkühlte Finger, die einen Schneeball halten, in der Hoffnung, er möge fest gepresst einem anderen eine Beule verpassen. Vielleicht so einem wie mir. Verzeihen Sie die holprige Prosa, welche zu allem Graus auch noch mit traditioneller Winter-Symbolik hantiert, wo sich der Januar just am Tage der Vernissage von Katharina Hinsbergs neuer Ausstellung anschickt, den Frühling vorwegzunehmen. Aber Katharina Hinsberg fand sich als junge Künstlerin in einer Welt strategisch operierender, verweisreicher, postmoderner Kunst, die sich aufmachte, entweder als komplexe, konzeptuelle Theoriegebilde die Räume zu füllen oder sich im 60er Gestus, nicht weniger konzeptionell, aber in der Hoffnung, die Postmoderne einfach vergessen zu können, an altbekannten formalen Fragen abarbeitete. So oder so, war es eine Zeit, in der die Räume enger wurden. Wenn man über Hinsbergs Werk liest, trifft man auf Paradigmen der frühen 90er, dann „dekonstruiert sie“ oder Paradigmen der 00er, dann „befragt“ sie offenbar. Doch als ich die stets etwas atemlos machenden Treppen zur Galerie Klein erklommen hatte, war da im Rahmen gleich neben der Eingangstüre nur Material für unvermitteltes Staunen.
Nach einer großen institutionellen Ausstellung, ihrer Werkschau im Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern, nimmt Katharina Hinsberg hier einiges aus der am 30.1. eröffneten Ausstellung „Werke auf Papier – Katharina Hinsberg/ Beate Terfloth“ im DKM in Duisburg vorweg. Dabei verortet der Titel „Linie und Schnitt“ in der Galerie Werner Klein zunächst nur zentrale Aspekte der Arbeitstechniken. Vielleicht deuten sie auch auf mehr, möglicherweise mag ich mich nur nicht in diese Richtung bewegen. Wo war ich noch? – Genau, beim Unmittelbaren.
Es sind rhythmisierte Reihungen, die im kleinen, bis gar Miniatur-Format den noch von erwähntem Treppenaufstieg atemlosen Betrachter auf den ersten Metern in eine eigentümlich angespannte Ruhe versetzen. Der Verständnisapparat stellt erst einmal rein technische Fragen. In akribischer Genauigkeit und doch eingebettet in die Spuren der Hände Arbeit wurden Muster in das Papier geschnitten. Wie schafft sie das nur? Mitunter sind es Vierecke mit Kantenmaß von höchstens einem Millimeter, welche nach und nach dem Blatt entnommen wurden. Die kleinen Papierschnitte der „Ajouré“ Reihe messen gerade mal um die 15×10 cm, meist sind sie vorsichtig mittels kleiner Schlaufen auf den ebenfalls weißen, kartonierten Hintergrund montiert. Das sich an den Kanten brechende Licht und die minimalen Schatten, welche es wirft, geben die fein strukturierten Formen den Blick frei, der fehlende Kontrast beruhigt das Auge, aber verstärkt eine Sogwirkung, die von allem Räumlichen ausgeht, selbst wenn der Raum nur die Tiefe eines Blatt Papieres misst. Zugleich erscheinen die Arbeiten nicht als Reliefs, auch wenn Werk und Hintergrund farblich verschmelzen. So schwebt der Scherenschnitt scheinbar in seinem Rahmen. Die geringe Betrachtungsdistanz lässt selbst im kleinen Format den Blick wandern. Mal erschließen sich so blattartige Strukturen die an Details aus Scherenschnitten des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts erinnern. Fließende Linien und eine durchaus Spannungspunkte setzende Struktur erinnern an den Jugendstil, andere Werke scheinen in Kontakt zu japanischer Papierkunst zu stehen, minimale, fast opake Muster schaffen ein subtiles Netz aus vertikalen und horizontalen Linien, ein fließendes Gitter, was immer dann verschwindet, wenn die Wahrnehmung versucht, einzelne Details einzufangen. Doch lassen diese Arbeiten eine konzentrierte Exploration zu, scheinen gar wie gemacht dafür.
Die zehnfach größeren, querformatigen Arbeiten „Diaspern“ genannt, entziehen sich einem entsprechenden Blick. Auch sie laden zur detaillierten Betrachtung ein, geben Arbeitsspuren preis, Risse, Reste der Vorzeichnung in Blei, doch die im oberen Bereich am Hintergrund fixierten Blätter heben sich nach unten hin ab, ein variabler Zwischenraum trennt die Blätter und quittiert interessanterweise den Versuch des Fokussierens mit Schwindelgefühlen. Dabei ist der dichte, rhythmisierte Zusammenhang der Formen der kleinen Werke hier aufgelöst, mehr wirken sie wie fallendes Laub oder Landmarken auf einer topographischen Karte.
Netz, Gitter und das Mysterium des Raumes bleiben die formalen Vorgaben auch jener Arbeiten, denen Katharina Hinsberg die Farbe Rot hinzufügt. Fast hätte ich „ihre Farbe Rot“ schreiben wollen, prägt rot doch viele von Hinsbergs großen Rauminstallationen. Hier erscheint es als durchbrochene Linie, Adern aus Tusche, die den weißen Hintergrund durchziehen und von weißen Linien aus Papier überdeckt werden. Eines der kleinen Werke hängt an einer Wandschräge, wird daher zuerst in einem 45 Grad Winkel gekippt wahrgenommen und erscheint für Momente objektgleich plastisch. Zugleich ist da etwas Organisches, ein undefiniertes Eigenleben in den roten Linien, dessen Puls einen aus dem Wunderland der Op-Art führt, hin zum Titel „Lacunae“, der fehlenden Stelle, also etwas mehr als einfach nur eine Lücke, eine spezifische Öffnung, Arterien, die Bindegewebe durchkreuzen. Wäre das Unmittelbare eine Forderung, es würde hier also mit starken Impulsen erwidert, dann würde Blut fließen. Aber vielmehr akzeptiert der Betrachter die kraftvolle Wirkung im Unbestimmten und sucht vielleicht von Werkgruppe zu Werkgruppe eine Bestätigung seiner nicht gesicherten Perspektive.

Katharina Hinsberg „Lacunae“, Tusche auf Papier, ausgeschnitten, 23 x 18 cm, 2015, Courtesy Galerie Werner Klein, Foto: Achim Kukulies
Die so herrschaftlich strengen, wie hoch empfindlichen Gitternetze der tatsächlichen „Gitter/Linien“ betitelten Werkgruppe könnten das abrupte Ende jener Sichtweise bedeuten. Wäre ihre Strenge nicht durchzogen von den, nun mit Farbstift aufgetragenen, roten Linien, die ein noch befremdlicheres Eigenleben entwickeln. Vage erinnern sie an die vergrößerten Bakterienkulturen, die Ettore Sottsass einst als Vorlage für Muster dienten. Tatsächlich sind sie aber viel wirkungsvoller, ein Eigenleben, der Form entwachsend. Eine Form, welche den 180×150 cm großen, frei hängenden Scherenschnitten nur mittels enorm akkurat in der Wand platzierter Nägel gewährleistet wird, über welche das Gitternetz gehangen wird. Ein Luftzug verändert für Momente die Distanz zur Wand. Wieder vibriert der Raum, seine Ordnung bleibt unberührt, aber seine Präsenz voller Rätsel. Ungreifbare Ordnung, also geordnete Unordnung, das Wunder, aller sich der Entropie widersetzenden Strukturen. Die spezifische Schönheit, jene Spannung aus Ordnung und Verwirrung bis an ihre Grenzen zu führen ohne sie zu beschädigen. Klassizismus ist das nicht!

Katharina Hinsberg „Ajouré“, Papierschnitt, 25,4 x 21 cm, 2015, Courtesy Galerie Werner Klein, Foto: Achim Kukulies
Sie können in bester Absicht auf ihr Werk „This machine kills fascists!“ schreiben, wie einst Woody Guthrie auf seine zerbrechliche Gitarre, sie können die Botschaft auch ihrer Naivität berauben, sie in ein System kluger Worte übersetzen und den Eintritt zum Verständnis mit den durchzuarbeitenden Metern eines Bücherregals austarieren, um so ein stetig kleineres Publikum mit ihrer Botschaft zu erreichen, sie können sich auf Linie und Winkel raushalten aus der Weltbeschreibung oder aber etwas schaffen, welches die Gedanken und Empfindungen für einen Moment fixiert, neu ordnet, an sich reißt und die Möglichkeit eines Zweifels anbietet. Vielleicht mündet der Zweifel in neue Strukturen. Wohin die Reise geht, ist nicht ganz klar, das ist die Gefahr, aber es ist schon enorm viel erreicht, wenn die Reise überhaupt angetreten wird. Katharina Hinsbergs Ausstellung in der Galerie Werner Klein mag vielleicht ganz anderes bezwecken, aber das mit der Reise, das bekommt sie auf beeindruckende Weise hin.
Artikelbild: Katharina Hinsberg „Gitter / Linien“, Farbstift auf Papier, ausgeschnitten, 180 x 150 cm, 2015 (Detail) Courtesy Galerie Werner Klein