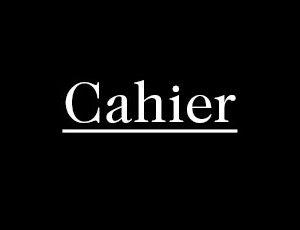Agnes Martin
Sabine Elsa Müller über die Retrospektive der amerikanischen Künstlerin im K20, Düsseldorf
Agnes Martin (1912 – 2004) musste nie um Anerkennung kämpfen. Von Anfang an wurde sie von wichtigen Galerien vertreten, von Kollegen bewundert und schon früh weltweit von großen Museen mit Einzelschauen gewürdigt. Sie begann ihr Kunststudium allerdings relativ spät, mit 34 Jahren, nachdem sie lange als Lehrerin Kunst unterrichtet hatte. 1976, inzwischen ist sie 64 Jahre alt und hat gerade an der documenta in Kassel und der Biennale in Venedig teilgenommen, dreht sie zwei Filme, nach eigener Aussage „aus Protest gegen den kommerziellen Film“. Der exotischere von beiden, ein Film über den mongolischen Herrscher Dschingis Khan, für den sie Kabuki-Schauspieler aus Japan und Indianer aus New Mexico engagiert hatte, wurde nie gezeigt. Aber „Gabriel“, ein Künstlerfilm in Spielfilmlänge, ist jetzt – leider nur an einem einzigen Abend – in Düsseldorf zu sehen. Über 90 Minuten begleitet die Kamera einen zehnjährigen Jungen bei seinen Streifzügen durch die menschenleere Landschaft. Vegetation, das Licht, der Wind. Welt, mit den Augen eines Kindes betrachtet. Felsen im Meer, von den Wellen umspült und immer nur für einen Augenblick sichtbar, werden zur ikonischen Metapher. Zu dieser Einstellung wird der Film am Ende wieder zurückkehren. Aus dem linearen Gehen und Schauen entwickelt sich eine zyklische Bewegung.
Die Ausstellung im K20 inszeniert das Leben und Wirken von Agnes Martin selbst als eine solche zu sich selbst zurückkehrende Bewegung. Bevor die chronologische Abfolge mit dem frühesten Werk, einem noch ganz der figurativen Malerei verpflichteten Selbstportrait aus dem Jahr 1947 einsetzt, zelebriert ein repräsentativer Vorraum die Künstlerin auf der Höhe ihrer Meisterschaft in den Neunziger- und Nullerjahren. Natürlich hat hier auch „Ohne Titel Nr. 5“ aus dem Jahr 1998 seinen Platz, das einzige Gemälde aus der Kunstsammlung NRW, die zu Recht auf diesen Besitz stolz sein kann. Denn Martins immer noch geringer Bekanntheitsgrad hat natürlich damit zu tun, dass nur sehr wenige Bilder von ihr in Museumssammlungen gelangten. Die meisten der ca. 140 Gemälde und Arbeiten auf Papier dieser Ausstellung stammen aus Privatbesitz. Dass es jetzt zu einer derart konzertierten Aktion vier führender Museen aus London (Tate Modern), Los Angeles (LACMA), New York (Guggenheim) und Düsseldorf kommt, lässt einen starken Willen dahinter vermuten, dies endlich zu ändern. Auch seit der letzten großen Ausstellungstournee in Europa 1991/92, die in Amsterdam, Münster, Wiesbaden und Paris Station machte, sind schon 25 Jahre vergangen.
„Ohne Titel Nr. 5“ vereint in der Tat viele Eigenschaften, die für die Malerei von Agnes Martin exemplarisch sind. Da sind zum einen die Streifen. Agnes Martin hat sich ausführlich mit Gitterstrukturen beschäftigt. Nach einer längeren Pause, in der sie angeblich nicht gemalt, aber sicherlich an ihrer Kunst weiter gearbeitet hat, nimmt sie 1974 das Malen wieder auf und gliedert nun die Flächen in horizontale oder vertikale Streifen, die einem regelmäßigen Rapport folgen. Sie hält aber gleichzeitig an den feinen Grafitlinien aus ihren grafischen Übungen fest und überträgt sie in die Malerei. Wie Vorzeichnungen bleiben sie durch die dünne Farblasur hindurch sehr gut sichtbar und bestimmen den Gesamteindruck entscheidend. Über die Bedeutung dieser schimmernden Grafitspur in den Gemälden von Agnes Martin sind ganze Abhandlungen verfasst worden. Dieser leichthändig an einem Lineal oder einer gespannten Schnur entlang gezogenen Linie haftet eine besondere Sensibilität an, die nichts Gewolltes hat. Wie beiläufig bezeichnet sie das Zusammentreffen zweier Farben oder Stimmungen, um sich zu den Rändern hin wieder aufzulösen.
Die Abfolge der Grundfarben Rot, Gelb, Blau wird in „Ohne Titel Nr. 5“ von zwei rahmenden blauen Streifen in einer sanften Balance gehalten. Aber von Rot oder Blau zu sprechen, scheint nicht wirklich angemessen, so zart und lasierend sind die Farben aufgetragen. Auch Martin hatte anfangs mit Öl auf Leinwand gearbeitet, aber mit der Erfindung der Acrylfarbe ein Medium an die Hand bekommen, das wasserlöslich ist und selbst bei starker Verdünnung seine Leuchtkraft nicht einbüßt, da keine Eintrübungen das einfallende Licht behindern. Sie weiß diese Eigenschaft aufs Äußerste auszureizen. In einem der gefilmten Interviews kann man sie bei der Arbeit beobachten: Sehr zügig und routiniert wird die wässrige Farbe Streifen um Streifen von oben nach unten in einem kontinuierlichen Ablauf „gefasst“. Vermutlich stellte die Malerin die Leinwand immer so, dass dieses vertikale Arbeiten mit fließender Farbe möglich war, auch wenn am Ende ein Gemälde mit Querstreifen entstand.
Agnes Martin erzählte oft davon, dass ihre Bilder im Geiste schon vollendet seien, bevor sie überhaupt zu malen begann. Die Abstände der Linien folgten komplizierten Berechnungen und die Auswahl und Abfolge der Farben wurde an Mustern erprobt. Dabei betrifft die Verwendung von Primärfarben überhaupt nur einen kleinen Teil ihres Werks; ihre besondere Liebe galt dem Spektrum der Grautöne zwischen Schwarz und Weiß. Natürlich entschied sie sich schon früh für das neutrale Quadrat und zwei Standardgrößen, 60 x 60 und 72 x 72 Inches (152,4 x 152,4 und 182,9 x 182,9 cm), als Einheitsformate. Die Zurückhaltung in Farbigkeit, Aufbau und Format lenkt die Aufmerksamkeit auf das Spiel der Modulationen und Nuancen. Von der sorgfältigen Vorbereitung der Leinwand mit einem Gipsgrund über die Selbstverständlichkeit der Grafitzeichnung bis zum Konzentrationsgrad der Farbpigmente in wässriger Lösung und dem Malduktus, der sehr regelmäßig bis stark bewegt ausfallen kann, spielen alle Faktoren zusammen. Daraus entwickelt sich etwas Eigenes, ein Klang aus Farbe und Form, der ihre Bilder einzigartig macht. Er ist so fein, dass man lange schauen muss, aber dann ahnt man allmählich, was sie meint, wenn sie in Bezug auf ihre Malerei ebenso wie auf den Film „Gabriel“ immer wieder wiederholt, es ginge ihr um nichts anderes als Glück, Schönheit und Unschuld.
Am Ende der Ausstellungsabfolge stellt die Kuratorin Maria Müller-Schareck den letzten Werken einige Arbeiten aus den Sechzigerjahren zur Seite. Die Parallelen sind verblüffend. Da ist sie wieder, diese zyklische Bewegung, in der Wiederbegegnung mit etwas Vertrautem in einer neuen Gestalt. Und auch die wasserumspülten Felsen scheinen in den geometrischen Formen, die aus dem grauen Dunst hervorragen, widerzuhallen.
Diese stille Malerei ist von einem ganz anderen Geist erfüllt als die farbintensiven Eruptionen einer Joan Mitchell, die derzeit in Köln für Aufsehen sorgt. Die beiden Künstlerinnen positionieren sich an den entgegengesetzten Polen dessen, was mit Malerei möglich ist. Aber sie haben auch einiges gemeinsam. Beide haben sich auf der Höhe ihres Erfolgs aus der betriebsamen Kunstmetropole New York verabschiedet und ihre Malerei in der Zurückgezogenheit entwickelt. Beide organisieren ihre Flächen mit linearen Strukturen, die den Bildraum als Membran zwischen dem Dies- und dem Jenseitigen definieren. Und könnte es nicht sein, dass ihr geringer Bekanntheitsgrad hier und heute gar nicht so viel mit der vermeintlichen geschlechtsbedingten Benachteiligung zu tun hat, sondern eher mit ihrer rigoros verteidigten Autonomie? So gesehen waren sie ihrer Zeit weit voraus, und die verspätete breite Anerkennung ist die Folge ihres hohen Anspruchs.
11. Februar 2016, 19 Uhr, Schmela Haus, Grabbeplatz: Gabriel, 1976, Farbfilm, 90 min
12./13. Februar 2016, Trinkaus Auditorium, K20, Grabbeplatz: Zweitägiges, hochkarätig besetztes Symposium in Kooperation mit der Hochschule für Künste, Bremen