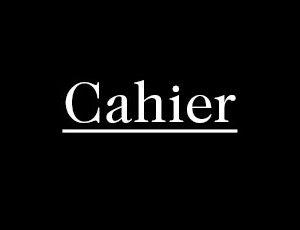Falsch verbunden oder Blick zurück nach vorn.
Lucy McKenzie – ‚Slender Means’ in der Galerie Buchholz, Köln, 10. Dezember 2010 – 26. Februar 2011
Fackele nicht mit dem Zweitrangigen. Verachte dein eigenes Zeitalter. Baue ein besseres. – Es ist nicht zuletzt die Verheißung auf solch eine Haltung, die unser uneingeschränktes Interesse verdient und uns gleichsam verpflichtet, ihr ein Stück weit nachzugehen. Eine Spurensuche führt uns daher in die Hinterhöfe eines mittelständischen aber global agierenden Betriebs.
Wie schon im vorletzten Jahr in beeindruckender Manier im Museum Ludwig, verwandelt Lucy McKenzie auch in ihrer dritten Einzelausstellung in der Galerie Buchholz den Ort in einen Raum. Dies gelingt ihr durch den stupenden Einsatz einer virtuosen Trompe-l’oeil-Malweise. Die Geschichte ihrer Lehrzeit am 1885 gegründeten Institut Supérieur de Peinture Van Der Kalen-Logelain in Brüssel, wo sie sich in dieser disziplinierenden Technik fortbilden ließ, ist bereits so häufig erzählt worden, dass ihr schon so etwas wie Kultstatus zuzukommen scheint und ein weiterführender Link zu einem schönen und informativen Interview von Andreas Reihse mit der Künstlerin für die Spex aus dem Jahre 2007 an dieser Stelle genügen kann.
Wenden wir uns stattdessen dem von McKenzie ausstaffierten Hauptraum der Galerie zu und versuchen, das Ambiente etwas genauer zu bestimmen. Auf die Maße der Wände kalkuliert, sind vier große Gemälde dort angebracht und geben umlaufend eine spezifische Innenarchitektur wieder. Auf den ersten Blick vermittelt dieser Raum den Eindruck eines großbürgerlichen Salons, mit einer umlaufenden, halbhohen Vertäfelung, einem Kamin und zwei Türen. Die Tapete oder Malerei über den Paneelen zeigt einen kräftigen Wolkenhimmel. Dieses Interieur wirkt als Ganzes jedoch etwas schmuddelig und hat anscheinend seine beste Zeit schon länger hinter sich. So zeichnen sich stellenweise Stockflecken ab und die Spuren ehemals angebrachter Bilder sind im nachgedunkelten Fond deutlich sichtbar. Als ein sehr schönes Detail befindet sich unmittelbar neben dem Zugang ein älteres Wandtelefon, umgeben von lustigen Kritzeleien, wie sie bei längeren, nervenzehrenden Telefonaten schon mal anfallen können. Der Augen täuschende Gesamteindruck ist prächtig gelungen und wurde bei meinem Besuch am Eröffnungsabend auch noch durch die Anwesenheit einer realen fetten Fliege untermauert, die auf der Himmelstapete entlang marschierte. Demnach haben wir es hier mit einer kulissenartigen Szenarie zu tun, wobei lediglich die fehlende Möblierung auf den Leerstand hindeutet und signalisiert, dass dieser Raum nicht mehr bewohnt ist. Wo aber befinden wir uns hier und welches Theaterstück gelangt hier zur Aufführung? Oder anders gefragt: Was ist der Inhalt? Und sind wir betroffen?
Der Titel der Ausstellung legt eine erste Fährte und netterweise liefert der Pressetext die entsprechende Erläuterung. Demnach bezieht sich ‚Slender Means’ auf den Roman ‚Mädchen mit begrenzten Möglichkeiten’ (so die deutsche Fassung) aus dem Jahre 1963 der schottischen Autorin Muriel Spark: „Vor langer Zeit – im Jahre 1945 – waren alle netten Leute in England arm, von einigen Ausnahmen abgesehen.“ So hebt dieser Roman an, der einige Geschehnisse in einem vierstöckigen ehemaligen Privathaus in Kensington unmittelbar nach Kriegsende schildert. Dieses viktorianische Gebäude war zu einem Wohnheim namens May of Teck Club umfunktioniert worden und beherbergte ‚minderbemittelte Damen unter dreißig Jahren, die genötigt sind, fern von ihrer Familie zu leben, um einer beruflichen Betätigung in London nachzugehen.’ Der Club sollte ihnen, laut Satzung, finanzielle Erleichterung und gesellschaftlichen Schutz gewähren. Die überaus amüsante, streckenweise mit gutem trockenem Humor gewürzte, lebendige Erzählung kreist vornehmlich um das Schicksal von fünf dieser Mädchen, die das oberste Stockwerk des Hauses bewohnen. Eingestreut finden sich auch diverse knappe Hinweise auf die Raumabfolge des Hauses und seine Einrichtung wohl aus der Zeit Eduards VII.. Unumwunden gebe ich zu, dass ich mit einiger Erleichterung feststellen konnte, dass ein Raum, wie Lucy McKenzie ihn uns in der Galerie vor Augen führt, im ganzen Buch keinerlei Entsprechung findet. Wohl spielt ein Telefon eine gewisse Rolle, es steht jedoch in einem Büro. Mehrfach wird eine Tapete erwähnt, mit der der Salon frisch tapeziert worden ist – in einem lehmähnlichen Braun. Kamin und Himmelstapete: Fehlanzeige. Die Gestaltung McKenzies bildet daher keine Ekphrasis, keine simple Illustrierung zu einem vorgegebnen Text. Zumal noch angemerkt verdient, dass das Gebäude gegen Ende des Buches durch die Explosion eines Blindgängers im Garten in Schutt und Asche versinkt und eins der Mädchen in den Tod reißt. McKenzies Bilder könnten daher eher noch an Hölderlins Sommergedicht gemahnen mit seinen Zeilen: „Und Wolken ziehn in Ruh’, in hohen Räumen, Es scheint das Jahr mit Herrlichkeit zu Säumen.“
Dennoch, ein morsches Zeitkolorit ist den Bildern schon abzulesen und die Stimmung, in die einen die Lektüre des Romans versetzt, wird eine Rolle gespielt haben. Noch mal Muriel Spark: „Tatsächlich war es auch kein ganz falscher Gedanke, dass dieses Mädchenheim die Miniaturform einer freien Gesellschaft war, einer Gemeinschaft, die durch die anmutigen Attribute einer gemeinsamen Armut zusammengehalten wurde.“ In Sätzen wie diesen, eher als in den nüchternen Beschreibungen der Zimmeraufteilung, lässt sich ein überzeugenderer Bezugspunkt zur Arbeit von Lucy McKenzie ausmachen. Aber verleitet der Blick in den Wolkenhimmel nicht eher zu Träumereien, denen jegliche Verantwortlichkeiten, eingedenk der notorischen Gleichgültigkeit der Welt, abgeht? Warum sollten wir die Historie durchpflügen, wenn sie uns nichts Besonderes oder Nützliches über unsere Gegenwart zu sagen hätte? Welchen Sinn vermittelt ein agieren als Agenten in dieser oder jedweder Vergangenheit?
Blicken wir also nochmals zurück: Der Wolkenhimmel ist ein nachgerade ureigenes Sujet autonomer Kunst, begleitet er doch das Zeitalter der Autonomie der Kunst vom späten 18. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart. Stellvertretend seien nur die Namen John Constable und William Turner angeführt. Das Bild eines mit Wolken geschmückten Himmels ist demnach das wohl sicherste Residuum einer Kunst, in der Gemälde dem Betrachter als individuelle Projektionsfläche und Zonen einer Freiheit von Zweckbindung dienen. Deutet sich hier etwa ein Widerspruch in der Haltung der Künstlerin an, die doch in ihrem Vorgehen stets die Anbindung an angewandte Formen der Praxis sucht und beauftragte Kunst keineswegs scheut? Als Beleg mögen die übrigen Arbeiten der Ausstellung dienen, finden wir dort zum einen doch einen schicken Schranktisch zur Aufbewahrung und Präsentation der graphischen Editionen des schottischen Künstlers Ian Hamilton Finlay für einen Privatsammler und im vorderen Ausstellungsraum McKenzies Entwürfe für die Werbeanzeigen der Herbst/Winter-Kollektion einer traditionsreichen Wiener Hutmanufaktur.

Auch diese Arbeiten scheinen von einer nostalgischen Sehnsucht nach handwerklichen Traditionen und dem Versuch ihrer Reanimation zu künden. Ergänzend lohnt übrigens auch ein erneuter Gang durchs Museum Ludwig, stößt man doch nach einigem Suchen dort auf ein Kabinett mit einem sorgfältig von der Künstlerin gestaltetes Arrangement ihrer Editionen: Plattencover, Poster und Seidenschals finden sich darunter und spinnen ein feines Netz sich überlagernder und miteinander verflochtener Schichten und Bezüge. Lucy McKenzie entgeht jedoch der Lifestylefalle indem sie sich weigert, die Beziehung zwischen autonomer und angewandter Kunst als unüberbrückbaren Gegensatz aufzufassen, denn schließlich können beide Spielarten gesellschaftliche Relevanz beanspruchen, wenn sie dies denn wollen. Eine politische Ökonomie der Kunst kann und sollte vielleicht auch offener und freier, eben anders gedacht und praktiziert werden können, gerade wenn oder weil die ihr zur Verfügung stehenden Mittel knapp und beschränkt sein mögen. Es lässt sich mit Roland Barthes daher behaupten, dass die gegenständliche Malerei nie etwas abbildet, sondern nur einen Namen sucht.