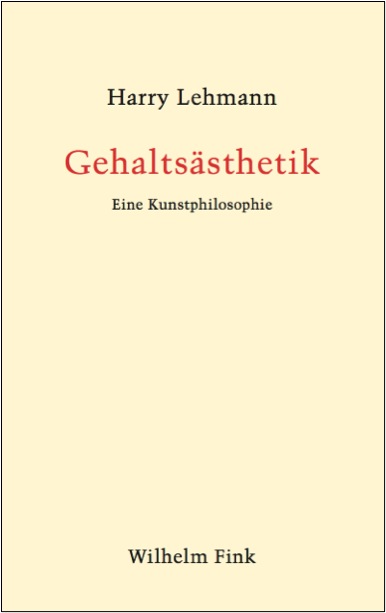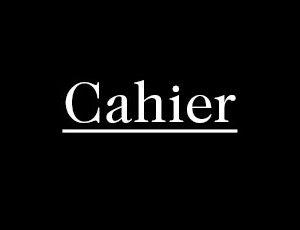Harry Lehmann, Gehaltsästhetik
Wenn der Luhmann zweimal klingelt – Andreas Richartz über Harry Lehmanns Neuerscheinung „Gehaltsästhetik – Eine Kunstphilosophie“, Wilhelm Fink Verlag, 2016, 261 Seiten, 63 s/w Abb., kart., ISBN 978-3-7705-5983-1, 19,90 Euro
Eigentlich müsste eine Rezension eines philosophischen Buches eine ernsthafte Auseinandersetzung und Darlegung der Stärken, Schwächen und Irrtümer des besprochenen Werkes zum Gegenstand machen. Eine solche Rezension erführe dann jedoch bald selbst eine Ausdehnung auf so viele Seiten, dass kein Mensch mehr gewillt wäre, diese Rezension überhaupt zu Ende – geschweige denn das besprochene Werk – zu lesen. Und wer will denn überhaupt philosophische Bücher über Kunst lesen? Darüber müsste doch dann gesprochen werden! Und welcher Geneigte (auch beharrlich als „Kunstinteressierter“ bezeichnet) will denn z.B. noch über Kunst und ihre gesellschaftlichen Produktionsbedingungen sprechen? Ein Glas Sekt mal hier und da auf einer Vernissage, schönschön! Aber über einen gehaltsästhetischen Impact des Dargebotenen ernsthaft analytisch diskutieren? Ja, sollte man. Mehr denn je! Allein das befördern zu wollen, ist Harry Lehmann nicht hoch genug anzurechnen.
Harry Lehmann ist an Niklas Luhmann geschult. Bereits 2005 („Die flüchtige Wahrheit der Kunst – Ästhetik nach Luhmann“, Wilhelm Fink Verlag) hat Lehmann mit seiner Kritik an Luhmanns Funktionsbestimmung des Funktionssystems Kunst als Subsystem der Gesellschaft gezeigt, wie ernst es ihm um eine Auseinandersetzung mit Luhmanns „lockerem Theoriedesign“ war. Mit seinen damaligen Reformulierungen des Luhmannschen Funktionsbegriffs der Kunst, ihren Strukturmerkmalen und Codierungen in den Humanmedien, sowie ihrer Anschlussmöglichkeiten an eine systemtheoretische Bestimmung von (lebensweltlichem) Sinn, legte er den Grundstein für ein eigenes ästhetisches Theoriemodell, das nun in einem ersten Ansatz vorliegt. Wiewohl dieser Ansatz im Kern allerdings zurückfällt hinter sein Buch von 2005.
Lehmann knüpft je nach Blickwinkel also an eine aus der Mode gekommene oder erst noch wieder verstärkt in den Blick von Kunstinteressierten geraten müssende Disziplin mit seinem neuen Buch an: „Gehaltsästhetik – Eine Kunstphilosophie“. So nennt er sein vorgeblich nicht normatives Programm, das er im Wilhelm Fink Verlag auf knapp 250 Seiten entwirft. Das Buch ist bereits seit Anfang des Jahres auf dem Markt und erfährt im Internet nachzulesende Polemiken (z.B. gegen die Behauptung, dass Modell sei nicht normativ zu verstehen) und gegen dieselben gerichtete Apologien.
Lehmanns Ausführungen sind komplex aber nicht unlesbar. Ein tieferer Gehalt wird sich allerdings nur dem erschließen, der bereit ist, es durchzuarbeiten. Badewannen-Essayistik geht anders, aber das kann und darf auch nicht der Anspruch sein. Komplexe Inhalte bedürfen noch immer einer komplexen sprachlichen Darlegung; das Buch ist eine diskursive Nuss, die geknackt werden muss. Was also umtreibt Harry Lehmann über die erwähnte Distanz von 230 Seiten?
Das Buch ist in vier Kapitel unterteilt, die eine sukzessive Erarbeitung seiner konstruktivistischen Programmatik bedienen. Im ersten Kapitel „Erfahrung“ betreibt Lehmann eine an gestalt- und neuropsychologischen, sowie systemtheoretischen Prämissen orientierte Erkenntnistheorie, die die Ausdifferenzierung von „Geschmack“ als Folge von ästhetischen Erfahrungen zu klären verhelfen soll. Dabei lässt seine biologistische Aufführung einer evolutionären Prozessualität der Entwicklung von Rezeption (u.a. am Beispiel des Jagdinstinkts von gestaltwahrnehmenden Katzen) durchaus vermissen, dass es – mit Bourdieu gesprochen – auch einen Missbrauch von „kulturellem Geschmack“ zur Etablierung von (und Exkludierung aus) Zugehörigkeit zu privilegierten Schichten gibt. Überhaupt machen bereits die ersten 30 Seiten seiner Kunstphilosophie klar: Um eine politische Dimension des „kompensatorischen Sozialsystems Kunst“ (Sloterdijk) wird es Lehmann nicht gehen. Und wie das so ist mit philosophischen Werken: Vollkommene Widerspruchsfreiheit gelingt schon während dieser ersten Seiten nicht. Ein Beispiel betrifft die Idee einer zu ihrem Ende kommenden ästhetischen Urteilsfähigkeit durch die Akkumulation von Erfahrung und ihre Überführung in eine Definition von „erfahren sein“: Die Idee steht im Widerspruch zu einer der basalen Annahmen der Systemtheorie selbst, deren Programm fortlaufende Anschlusskommunikationen (Anschlussfähigkeit zu generieren ist mithin der Sinn einer jeden System-Operation), also eben KEIN Ende eines jeweiligen Ausdifferenzierens annimmt. Ein Ende aller Ausdifferenzierung (im Sinne von „erfahren werden in der Bewertung von Kunst“) wäre gleichbedeutend mit der Verweigerung des Vergleichens, also dem Zusammenbruch des Systems. Was die Frage aufwirft, ob sich die unfreiwillige Parodierung eines solchen Zustands nicht doch längst innerhalb der „Kunstszene“ etabliert hat, wo eine flächendeckend erschreckende Sprachlosigkeit zwischen Künstlern (untereinander) und Publikum, ja eine nahezu vollendete Anschlusslosigkeit von Kommunikation herrscht.
Doch solche Einwände mögen wie gedankliche Peanuts erscheinen angesichts eines Buches, das sich immerhin bemüht, philosophisch-stringente Argumentationen zu entwickeln. Dass Lehmann dies nicht immer gelingt und man irgendwann den Eindruck gewinnt, doch nur einen aufgeblähten Essay vor sich zu haben, ist einem einzigen Umstand geschuldet: Nirgends verrät Lehmann die epistemischen Grundlagen seiner Methodologie. Präzise, trennscharfe Begriffsbildungen sind seine Sache ebenso wenig. Ein Sammelsurium von durchaus zu bejahenden Darlegungen begegnet der Tatsache, dass ihre Heranziehung keinem nachvollziehbaren methodischen Auswahlkriterium folgt. Und gerade, wenn angenommen werden will, dass Lehmann sich bereits 2005 vorab entschuldigt hat, als er im ersten Teil seiner Luhmann-Entgegnung schrieb: „Wenn es keine Grenzen der Genauigkeit gibt … dann ist mangelnde begriffliche Präzision noch kein Gegenargument“, darf gesagt sein: Diese Entschuldigung muss leider auf sein gesamtes neues Buch ausgedehnt werden.
Wie bereits angemerkt: Eine Rezension eines philosophischen Buches kann mangels Raum nur eine schlichte Beleuchtung beinhalten. Sie kann nur eine Leseaufforderung oder ein abraten von ihr enthalten. Insgesamt lässt sich sagen: Lehmann rekonstruiert zunächst (z.B. im Anschluss an Kants ersten Teil seiner „Kritik der Urteilskraft“) eine sinnvolle Phänomenologie evolutionärer Ästhetik, ihrer Parameter und gestaltwahrnehmenden Eigenwerte (Schönheit, Erhabenheit, Ereignis und Ambivalenz), geht in einem kurzen Kapitel auf eine „Sphäre des Ästhetischen“ ein, die er (sozial kontingente) Übertragungswerte nennt (Mode, Design, Kosmetik, Werbung) und kommt im Kern des Buches auf diejenigen Werte, die als Reflexionswerte den gehaltsästhetischen Mittelpunkt seines Theoriemodells erörtern und vertiefen helfen sollen. Allerdings – ja, ich wiederhole mich – erschließt sich nie, warum er welche Grundlagen für seine Reflexionen über den Gegenstand wählt. Hier fließt ein wenig Flusser-Phänomenologie, dort ein bunter Strauß konstruktivistischer Thesen. Im dritten Teil des vierten und umfangreichsten Kapitel des Buches, überschrieben mit dem Begriff Reflexionswerte, gewinnt Lehmann schließlich in der Unterscheidung und Ausarbeitung dreier verschiedener Ästhetiken konzeptueller Kunst (die auch solche moderner Musikästhetiken umfassen) seinen Ausgangspunkt zurück, der da konstatieren will, ein neues ästhetisches Paradigma einzuführen, dass die Postmoderne hinter sich lässt; eben seine „Gehaltsästhetik“. Dass dies oftmals, ebenso wie seine an feuilletonistische Kunstkritik erinnernden Sentenzen über Ai Weiwei oder Damien Hirst, weniger nach Philosophie als nach einer Besprechung singulärer Werke und dabei – alles in allem – nicht gerade nach einer Neuerfindung des ästhetischen Theorie-Rades klingt, geschenkt. Dass er aber gerade hier, im wichtigsten, weil nach genuin Lehmannscher Philosophie Ausschau haltenden Teil des Buches, einzig Beispiele aus der etablierten Hochkultur heranzieht, ohne jede Berücksichtigung neuer Medien und ihrer künstlerischen Entwicklungen innerhalb einer kreativ hochspannenden Subkultur, lässt den gesamten Text vor jeder eingehenden Beurteilung wenig originell bis antiquiert erscheinen. Da hilft auch die letztendliche Wiederholung eines angenommenen Freiheitsversprechens aller Kunst wenig. Trotzdem: ein ernstes, ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit.
Artikelbild: Frieze Art Fair im Regents Park, London. Foto: Linda Nylind