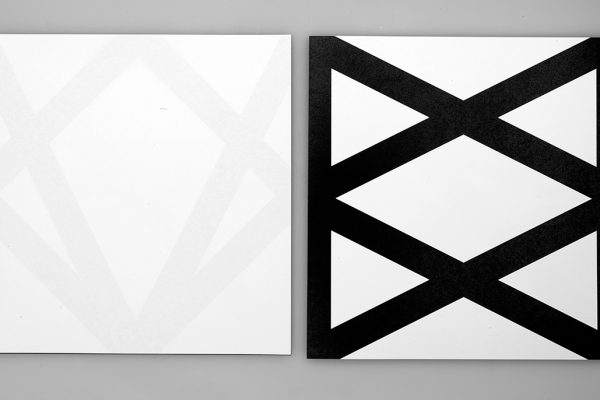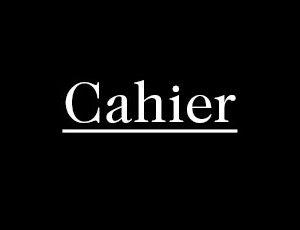Zeiten des Wandels
Oliver Tepel über „Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker“, im Kunstpalast, Düsseldorf, verlängert bis 24.5.21
Draußen zauberte klares Winterlicht glitzernde Akzente auf den grauen Rhein. Drinnen plante man seine Bewegungen im Fluss der abgezählten Besucher und ihren individuellen Verweildauern vor den Werken noch genauer, als man es sonst schon tut. Fast tänzerisch, wenngleich ungeübt ob der ungewohnten Situation hielt man Distanz zueinander, weniger zur Kunst. Unbeholfene Bewegungen vor technisch ausgefeilten Bildern – Bildern der Einsamkeit. Dann kam der Winterlockdown.
Wieder ganz im Stillen, gleich einer selbsterfüllenden Prophezeiung, warteten die entvölkerten Szenerien, verschneiten Landschaften, Friedhöfe, verfallenen Gemäuer, die schweigende See, das Sonnenlicht, welches in die Lichtung eines Waldstücks fällt und die wenigen, meist vereinzelten Menschen in den Bilderwelten auf neue Besucher. Oder war es ihnen gar ganz recht so? – Die Moderne wird sich ihrer selbst vor gut 200 Jahren in der Kunst gewahr. In der Malerei der Romantik erscheint die neue Zeit, sie strahlt nicht, wir erleben sie weniger als Geste des Aufbruchs, denn als das Innehalten eines Wanderers, ein sehnsüchtiger Blick zurück auf eine Vergangenheit, die es nie gab. Wie manifest musste diese Verunsicherung sein?

Caspar David Friedrich, Felsenriff am Meeresstrand, 1824 22×31 cm Öl auf Leinwand Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, © Gnamm – ARTOTHEK
Zu ihrem Beginn nimmt sich die Ausstellung jenes neuen Bilds des Menschen an, seiner Darstellung in den Malgründen, bevor er diesen im weiteren Weg durch die Räume aus dem Zentrum der Anschauung entgleitet. In einem Bild Georg Friedrich Kerstings aus dem Jahr 1812 starrt Caspar David Friedrich in ein Nichts, welches ihm eine just bearbeitete Leinwand verstellt – oder eröffnet. Im Widerschein des von schräg hinten einfallenden Lichts macht es den Eindruck, als würde eine gewisse Leuchtkraft von seinem Werk ausgehen, ein Leuchten, unauffindbar im aufmerksamen, wie zugleich abwesenden Blick der Knopfaugen des Portraitierten. Er steht im Licht und doch am Rand einer Szenerie, deren Biedermeierfragilität aus geometrischen Linien keine Ruhe findet und doch nicht belebt erscheint. Kaum drastischer könnte der Kontrast in dem gern gezeigten Atelierbild des Düsseldorfers Johann Peter Hasenclevers aus dem Jahr 1836 sein. Fünf Künstler agieren, zum Teil gestenreich, an ihrem Arbeitsplatz miteinander als sei dieser eine Theaterbühne. Und tatsächlich beobachten im Hintergrund zwei Personen das Miteinander, derweil sich von Links der dramatische Gestus einer Skulptur einmischt in das Hin und Her aus Gebärden, Blicken, Posen. Gleich eines alten Mannes erscheint der Mittdreißiger Friedrich im Vergleich zur Agilität der jungen Düsseldorfer Künstler. Im Anblick beider Werke wird einem die ab 1830 einsetzende, neue Perspektive unvermittelt klar: Friedrichs Absage an das Lebendige erscheint hoffnungslos veraltet vor einer Szene, die wir uns auf diese Weise auch noch heute in der Düsseldorfer Kunsthochschule vorstellen können.

Georg Friedrich Kersting, Caspar David Friedrich in seinem Atelier, um 1812, Öl auf Leinwand, 53,5 x 41 cm Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie © Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie Foto: Jörg P. Anders
Jene Zugewandtheit bescherte den Düsseldorfern binnen Jahren immensen Erfolg. Ihr Blick auf die Welt erschien befreit von etwas Bleiernem, Verwirrenden in Friedrichs Werken. Sie waren moderner, ohne dieses Attribut wirklich einzufordern. Bald jedoch verschwand die Malerei der Romantik, wie nahezu alle Kunst des 19. Jahrhunderts. Alt und schwer verständlich erschienen ihre Themen und Fragen aus der Perspektive der modernen Avantgarde, welche unseren Blick auf alle Kunst völlig umkrempelte. Doch in der Perspektive dieses Blicks geschah etwas eigenartiges, die Allegorien und Seelenlandschaften Caspar David Friedrichs übten einen befremdlichen Reiz auf eine neue Generation Betrachter und nicht zuletzt auf einige moderne Künstler aus. Er knüpfte an, wo sich das Bild vom Abbildenden löste, ob seines Sinnes für den Effekt, oder in seinen Darstellungen der Einsamkeit.

Caspar David Friedrich, Frau am Fenster, 1822 Öl auf Leinwand, 44 x 37 cm Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie © Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie Foto: Jörg P. Anders
Friedrichs 1822 entstandene, in eher bescheidenem Format gemalte „Frau am Fenster“ wirkt heute intensiv und scheinbar zeitlos. Das Werk hat sich möglicher einstiger Bedeutungen entledigt, wird kaum noch als religiöses Bild wahrgenommen, selbst wenn das Fensterkreuz weiterhin das obere Bilddrittel bestimmt, auch die Vorstellung der Unfreiheit verliert sich mit dem Vergessen davon, wie sich eine Frau 1822 unbegleitet in der Öffentlichkeit bewegen konnte. Doch eine unbestimmte Sehnsucht verbleibt im Werk. Subtile Unruhe entströmt dem Bild. So unbeweglich die Frau am Fenster steht, scheint sie dennoch nicht lang zu verweilen. Ein Eindruck, vermittelt vom fahrigen Farbauftrag, in dem ihr Kleid gemalt ist, als flatternde Spannung in der akkuraten architektonischen Geometrie ihrer Umgebung. Mag sein, dass es die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens meint, doch im Empfinden heutiger Betrachter scheint die angedeutete Zeitspanne kürzer, selbst, wenn sie die Unendlichkeit befragen sollte. Erscheint ihr Kleid so nicht auch leicht transparent? Die finnische Künstlerin Elena Brotherus positionierte sich für eine Photographie ihrer „Love bites“ Serie in Rückenansicht vor einer vergleichbar komplexen Fensterkonstruktion, ihr weißes, halbtransparentes Kleid öffnet sich am Rücken so weit, daß es den Blick auf einen roten Fleck preisgibt, ein Bluterguss unter ihrem Schulterblatt, ein „Liebesbiss“ wie es der Titel andeutet? Ist die Sehnsucht der Frau in Friedrichs Werk eine des Verlangens, eine in bürgerlicher Distinktion offenbarte Geste?

Johann Peter Hasenclever, Die Sentimentale, um 1846-47, Öl auf Leinwand. 36,5 x 30,5 cm ©Sammlung Kunstpalast, Düsseldorf
Unfern von Friedrichs Bild entdecken wir eine sehr unmittelbare Darstellung des Verlangens. In einer Mondscheinszenerie blickt eine junge Frau von ihrem Stuhl aus in den Nachthimmel. Johann Peter Hasenclever nannte sie „Die Sentimentale“ und der Titel multipliziert die Vieldeutigkeit des Werks. Wirkt sie nicht ein wenig naiv, offenen Mundes und mit ihrer fast wächsernen Haut? Vorgeblich zufällig entblößt der Stoff ihres Oberteils ihre Schultern. Auf dem Fenstersims liegt eine Ausgabe von Heinrich Claurens Erzählung „Mimili“, auf dem Tisch hinter ihr die Inspiration zu Claurens Buch, Goethes „Werther“, sowie ein, an die junge Dame namens Fanny gerichteter Liebesbrief. Claurens vielgeschmähtes Buch berichtet von einer dramatischen Liebesgeschichte mit gutem Ende, doch was die zeitgenössische Kritik am meisten in Aufruhr brachte, waren die unverhohlen erotisierenden Beschreibungen der jungen Frau im Blick ihres Geliebten. Hasenclever scheint sich über das Buch, wie all die aufbrausende Gefühlswelt des Sturm und Drang zu amüsieren, bringt jedes Symbol der Herz und Schmerz Prosa in seinem Werk unter. Und doch vermag sein Ärger nicht darüber hinwegzutäuschen, daß Claurens zaghaft einem neuen Frauenbild Ausdruck gab. Nicht nur, daß Mimili sich jene Freiheit nahm, erotische Signale zu senden, sie bestimmte über ihr Leben, entgegen des Vaters Bedenken. Im englischen Sprachraum kursierte eine in Liedform gefasste Version der Geschichte unter dem Titel „Jack-A-Roe“ oder „A wealthy merchant“, hier wartet die junge Frau nicht allein angstvoll erbenend, als es besorgniserregende Nachrichten über ihren, in den Krieg gezogenen Liebsten gibt, sondern schneidet sich die Haare, verkleidet sich als Mann und reist ihm hinterher, um ihn verletzt zu finden und zu retten. So fern Hasenclevers Sentimentale dieser Version ist, so atmet seine, dem lustvollen Blick, wie des Hohns Preisgegebene, doch eine Freiheit, die der Künstler festhielt, ohne es intendiert zu haben.
En passant schafft die Betrachtung der Bilder heute einen Moment innerer Freiheit, welche für Minuten nun bereits vom Alltag unter Coronabedingungen abzulenken vermag. Doch findet die Sentimentale nicht so unmittelbar ihren Weg in unsere Zeit, wie Friedrichs Frau am Fenster. Dies wird der Düsseldorfer Romantik, welche sich in die Moderne aufmacht, wie unschwer im Realismus von Wilhelm Josef Heines „Gottesdienst in der Zuchthauskirche“ erkennbar ist, zum Verhängnis. Oftmals wirkt sie heute älter, befremdlicher als die Weltverschlossenheit des Greifswalders und seiner Dresdner Romantik der Elegie.
Der Weg des Besuchers führt von nun an in die Einsamkeit. In Karl Friedrich Lessings „Klosterhof im Schnee“ fror die Zeit im unerbittlichen Winter ein, vor kurzem noch bewegtes Wasser zu Eis erstarrt, das Grün der Natur unter einer flockigen Masse verborgen. Der Schnee in Caspar David Friedrichs „Kreuz im Gebirge“ liegt brach, als unsaubere, harsche graue Struktur, keine Ruhe in der Totenruhe. Der Tod als das, was von der Pastorale übrig blieb. Selbst die schwarze Romantik, die vampirzahnbesetzt, „der Tod ist nicht das Ende“ zischeln würde, erscheint dieser Kargheit gegenüber hoffnungsvoll.

Caspar David Friedrich, Lebensstufen, um 1834 Öl auf Leinwand 72,5 x 94 cm © Museum der bildenden Künste, Leipzig Foto: InGestalt Michael Ehritt
Wohltunend geradeswegs, die ebenso stummen, aber detailgenauen und liebevollen Naturbetrachtungen der kommenden Räume. Weiter führt uns der Weg zur See, wo Caspar David Friedrichs „Lebensstufen“ das Nichts auch im Kleinsten entdeckt, eine Generationskette malend, vor dem Anblick der würdevollen Segelschiffe, welche still ins Nichts segeln. Die Dramatik des Bilds ist jene der leisen Auflösung, diametral zu der tosenden See von Andreas Achenbachs Seestücken Düsseldorfer Zuschnitts und auch in diesem Vergleich erscheint die geradewegs fatale Passivität im schimmernden Licht so viel zeitgemäßer, als denn die wütende Dramatik. Eine ganz andere Form der Erhabenheit erreichten bald die Landschaften jener Düsseldorfer Maler, welche in die USA auswanderten. Ein „Eifelmoor“ von Johann Adolf Lasinsky wirkt nahezu von jenem lebensbejahenden Pathos des Wilden erfüllt, selbst, wo es mehr über die Stimmung, als denn die Unfassbarkeit der Landschaft an sich zu staunen scheint.
Allmählich nährt man sich den heute befremdlichsten Werken in ihrer historisierenden Deutschtümelei der Heldengeschichten, welche nach Napoleons Sieg an Popularität gewannen und den verhängnisvollen Weg bis in den ersten Weltkrieg hinein vorzuzeichnen scheinen; dass die Schlafwandler jener Tage vielleicht Irrende im Nebel waren, legen Carl Friedrich Lessings Bilder von Kreuzrittern und Belagerungen nahe. Derweil Caspar David Friedrichs „Frau mit Rabe am Abgrund“ in grausig scharfkantig konturierter Form ein germanisches Deutschland vor der Christianisierung beschwört.
Dann nahezu plötzlich erwacht inmitten der Wälder und Landschaften mit ihren Verlorenen und einsamen Wanderern die Moderne, in Anders Askevolds „Bachbett“ aus dem Jahr 1856 durch seine Reduktion auf ein nahezu abstraktes Formenspiel oder in Julius Rollmanns „Felshöhle mit Feueresse“ von 1859 und „Felsgeröll“ von 1861 – auf den letzten Metern erweist sich die Düsseldorfer Perspektive als offen für das, was anderswo Courbet vorbereitete.

Anders Askevold, Bachbett, 1856, Öl auf Leinwand, 37 × 49 cm, ©Kunstpalast, Düsseldorf, Sammlung der Kunstakademie Düsseldorf (NRW)

Johann Wilhelm Schirmer, Bachschleuse, Um 1827-28, 32 x 40,2 cm, Öl auf Papier/Pappe, ©Kunstpalast, Düsseldorf, Sammlung der Kunstakademie Düsseldorf (NRW)
Wochen nach dem Ausstellungsbesuch bleiben all die Studien und Skizzen der Pflanzen, Bäume und Waldlandschaften erstaunlich lebendig in Erinnerung. Ihr Schweigen wird belohnt und im anrückenden Frühling erscheint es von Vogelgezwitscher versüßt.
Anders Friedrichs Wartende am Fenster. Sie steht da und verbildlicht, was nie geplant war, die Einsamkeit im Zeitenwandel. Dieses Werk kriecht einem nun unter die Haut, so spürbar seine sehnsuchtsvolle oder auch sehnsuchtsleere Unbewegtheit. Doch dies liegt nicht an der vergangenen Moderne, auch nicht an der Kunst der Postmoderne, sondern dem Erleben einer Pandemie. Friedrichs visualisiertes Empfinden einer Haltlosigkeit des, so scheint es, gottverlassenen Individuums bebildert das Harren, wie das beschworene Miteinander unserer Tage.
Aus dieser Zeit der Warteschlangen musste, nach bedrohlich steigenden Inzidenzwerten, alsbald wieder eine der vollendeten Einsamkeit werden, was zu der eigentümlichen Konstellation führte, dass eine Ausstellung mit Bildern über die Einsamkeit einsam blieb. Eine Ausstellung zur Zeit, das war nicht geplant, zumindest nicht auf diese Weise und niemand hätte es so planen wollen. Doch die Laufzeit wurde verlängert! Derzeit ist die Ausstellung wieder zu besuchen. Sie ist nun ein Spiegel unserer Zeit und wer sie nicht im Düsseldorfer Kunstpalast sehen kann, dem sei der gute und umfassende Katalog empfohlen.
Artikelbild: Caspar David Friedrich, Ziehende Wolken über dem Riesengebirge, um 1820 Öl auf Leinwand, 18,3 x 24,5 cm Hamburger Kunsthalle © Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Elke Walford