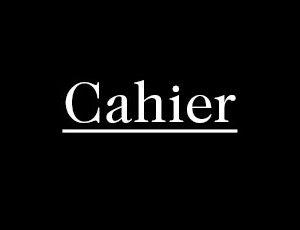Katzenschattendimensionen
Oliver Tepel über Gillian Carnegie bei Galerie Gisela Capitain, Köln, bis 1. Juni 2013
Weil es synthetisch ist, vergleichbar der Möglichkeit endloser Neukombinationen von Worten in der deutschen Sprache, deswegen ist ein Bild nie ein Abbild – oder besser: Nie nur ein Abbild. Es ist ebenso Konstruktion, Urteil, Verzerrung, Verklärung und ein Problem der Erinnerung.
Gillian Carnegie hat in ihrer Malerei die komplexen Verstrickungen des Abbildens auf vielfältige Weise thematisiert und dabei stets auch vergessen gemacht, daß ihre Arbeit einem derart analytischen Anliegen zugrunde liegen könnte. Dabei misstraut sie der Korrelation oder gar dem Versuch der Übersetzung von Bild in Sprache noch weit mehr, als den Prinzipien der malerischen Abbildung. Nur sporadische Bildtitel, keine Pressetexte, nichts was sich im Sinne des Linguistic Turns vor das Bild schieben könnte und darin sehr wohl auch die Ablehnung der Idee, dies sei längst in unseren Köpfen geschehen.
Wie zur Veranschaulichung dieser Tatsache konfrontiert die Einladungskarte und das mit ihr korrespondierende Werk der Ausstellung den Besucher erstmal mit einem unmittelbaren optischen Effekt, einem Flirren, verursacht durch das regelmäßige Wiederholen einer grafischen Struktur. In tiefem Rot und Grün auf dunkelbeige Hintergrund gemalt vermag sich der Blick sogar für Momente an minimalen Unregelmäßigkeiten der gemalten Ausführung des Musters festkrallen, während er bei grafisch exakten Variationen (wie sie derzeit auf Plattenhüllen en vogue sind)
eclecticollective.com
optimomusic.com
völlig hilflos mitgerissen wird.
Doch die Botschaft ist deutlich: Was hier passiert, ist gänzlich unberührt von der gesprochenen Sprache, es ist das Vermögen des stereoskopischen Blicks ad absurdum geführt. Daß dies auch Carnegies Thema sein könnte, als sie mit dem Portraits entblösster Pos vor gut zehn Jahren für Aufsehen sorgte, entging so manchem, sich im Neo-Rokoko oder der malerischen Re-Inszenierung eines Yoko Ono Films wähnenden Betrachter.
In ihrer letzten Ausstellung für Gisela Capitain zeigte sie 2008 detaillierte Ansichten von Straßenszenarios, Fensterblicke, scheinbar unspektakulär, doch voll dezenter und enorm wirksamer Verschiebungen manifestiert in den mannigfaltigen Linien der stolzen Fachwerkbauten, der Leitungsdrähte, des Horizonts und den mehrfach verwinkelten Blickachsen. Und doch erschien dies gleich einem Hintergrundrauschen der so exakten wie stimmungsvollen Werke. Gillian Carnegie weiss, daß ihre Experimente nicht als Skizzen funktionieren.
In der aktuellen Ausstellung dominieren Treppen und geometrische Achsen. Nein, das ist falsch, es dominieren Pflanzen und vor allem schwarze Katzen. Dann gibt es noch das Bild eines Schwimmers im Wasser („Nager“, 2012), vielleicht das am ehesten zeichnerisch skizzenhaft ausgeführte, aber mit seiner klaren Fluchtpunkt- Perspektive und dem herausragenden und zugleich auf der selben Ebene gemalten Kopf anschaulichste Werk. Es erinnert an die Szenarien aus Bastien Vivès „Der Geschmack von Chlor“
Auf der ihm gegenüberliegenden Wand, ist das recht kleinformatige Bild eines Kirschbaums weit detaillierter ausgeführt, so daß seine Äste und Blüten im Licht flirren. Mit etwas Konzentration erscheint das Bekannte jedoch ebenso flächig und grafisch wie das Wasserbassin auf der anderen Seite des Raumes. Genauso aber fordert es auf, sich einzubeziehen und den Gewinn der assoziierten Stimmungen zu erleben. Vielleicht ist der Wunsch die größte Kraft der gedachten Dimension. Jedes Bild scheint eine Belohnung zu sein, die Verführung der in den gedachten Raum hinein verlegten Achse. Hier umkreist Carnegie die Verheissungen der Renaissance ein ums andere Mal. Doch ihre Perspektiven sind erst in einer Ära der Photographie denkbar. Doch dazu später. Denn ebenso findet sie Beispiele für die Antithese des Raums. Ein anderer Kirschbaum ganz im Stil japanischer Malerei des 19. Jahrhunderts, reduziert auf eine symbolische Formensprache, wenngleich dabei mit einem aufsehenerregend getiegerten Stamm, löst jene erwähnte Raumachse auf. Fast scheint es wie ein Kommentar zu Felix Reidenbachs Analytischer Bildergeschichte „Hinomaru – Himmel ohne Horizonte“.
Doch Carnegies Humor ist stiller, versteckter und noch mehr hingerissen von der Ästhetik des Objekts. So gestaltet ein vages Muster aus Linien den Hintergrund des Bildes, ein Muster, welches in einem anderen Werk eine Raumecke markiert, in welcher ein Blumenstrauß steht.
Doch just als es scheint, Gillian Carnegie lade ein zu einem Tanz mit dem Betrachter entlang eines beherrschbaren Regelwerks, malt sie eine Reihe dunkler, in einem leichten Grünton schimmernder Bilder von Treppenabsätzen. Holztreppen, gut vorstellbar in den Fachwerkbauten ihrer älteren Werke. Es sind Perspektiven von Photographien, man könnte die Idee haben, der imaginierte Photograph interessierte sich nicht für die Architektur sondern vielmehr für eine schwarze Katze, sie heisst „Prince“. Die drei nach seinem Namen betitelten Werke zeigen in unterschiedlichen Formaten sehr präzise gemalte Treppenabsatzszenarien. Carnegies nahezu zeichnerische Exaktheit verliert sich in manchen der schwarzen Flächen, seien es Geländer oder der Körper der Katze. Spuren der Pinselführung werden sichtbar, gleich jenen Lichtreflexionen, welche auf dem Fell einer tiefschwarzen Katze verwirrende Highlights setzen, aber nicht in einem Versuch, diese nachzustellen, sondern als eine gesuchte Dissonanz. Dabei erscheint Prince in den Werken mal Schattengleich, dann wieder mit einem sehr lebendigen Blick, ebenso wechselt das Treppenszenario von einem einfachen „Stufe mit Katze“ hin zu einer dieser leicht verdrehten und verwinkelten Ansichten, welche im Hauptwerk der Ausstellung den Eindruck generiert, das Bild würde mit der Oberkante voran auf den Betrachter hin kippen. Diese Perspektiven sind jene des nachlässig gewählten Ausschnitts einer Photographie. Der Rahmen definiert einen zusätzlichen Horizont, der umgebende Raum ebenso. Jenseits aller Worte konstruiert die Wahrnehmung also Dissonanz, ja Verwirrung.
Prince dominiert diese, in der Beschreibung allzu formal erscheinenden Settings noch viel mehr als der Blumenstrauß oder der Baum in den anderen Werken. Die Katze erscheint gleich einem Geist, der sich keine Mühe gibt, das Bild oder sein Sujet zu beleben, sondern still den Betrachter manipuliert. Ist Prince demnach nichts anderes als Gillian Carnegies Komplize in ihrer Auseinandersetzung mit uns und unserem Glauben an Bilder? – Nein, denn diese Malerei ist weder rhetorische Übung noch strukturelle Exegese. Sie betont vielmehr jene Möglichkeiten, welche die Photographie der Malerei geschenkt hat und sie erinnert an unzählige seit der Ära der Photographie vergessenen Möglichkeiten abbildender Malerei. Ja, jedes Bild ist Manipulation – aber warum auch nicht?