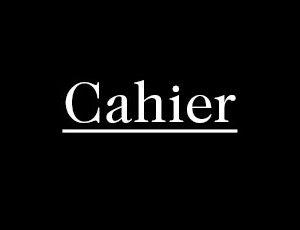Uncreative Writing
#kratzenandenuntergrenzenderkultur – Kenneth Goldsmiths „Uncreative Writing“ ist endlich auf Deutsch erschienen. Andreas Richartz über die etwas angejahrten Aneignungsversuche, das Netz zur digitalen Ästhetisierungsmaschine zu transformieren.
Sind Sie bereits einmal ins Schwitzen gekommen, weil es in Ihrem Schädel hämmerte, unbedingt etwas schaffen zu müssen, das neben Zeit auch Ihren Grips beanspruchen würde? Z.B. angesichts einer gnadenlosen Deadline in der Schule, der Universität, dem Betrieb oder einer High-End-Kulturinstitution? Natürlich sind Sie das. Kenneth Goldsmith würde Sie auslachen! Das Einzige, was Sie jetzt brauchen, würde Kenneth Goldsmith sagen, ist ein paar verinnerlichte philosophische Kernüberzeugungen, ein bisserl digital-technologisches Knowhow und, tja, leider Zeit. Denn anspruchsvolles Räubern kann verdammt zeitaufwendig sein. Das zumindest ist sicher nach der Lektüre.
Kenneth Goldsmith, Jahrgang 1961, US-amerikanischer Dichter, Hochschullehrer und Erfinder des „Unkreativen Schreibens“, versetzt dem goldenen gesellschaftlichen Kalb Kreativität einen heftigen Tritt. Dabei befindet er sich ironischerweise in schönster Nähe zur Realität z.B. unserer Schulbetriebe, die – statt ihrem eigenen Kreativitätsverdikt zu folgen – Myriaden von wissensbulimiegeschädigten Kindern hervorbringen, denen weder die Möglichkeit zur Kreativität noch zur konsequenten Alternative dazu offen gelassen wird. Die Goldsmith-Alternative: Das Netz nutzen als unendliche Mosaiksteinchen-Ressource zum jeweils zu behandelnden Thema. Konkret: Zur Erschaffung einer neuen netzbasierten Literatur, die ihre Selbstreferenz dadurch auf die Spitze treibt, indem sie sich aus dem Geist der Maschine mithilfe generalisierter Algorithmen selbst generiert. Um der Sprache die Bühne zu bereiten, ganz und gar nur noch sich selbst auszudrücken. Soweit die Utopie.
Doch nicht allein aus pädagogisch-didaktischen Gründen ist es Schade, dass Goldsmith keine ihm gemäße Untersuchung eines fragwürdig gewordenen Kreativitätsbegriffs anbietet. Ein Umstand, der eines der größten Defizite darstellt in dieser zu großen Teilen wunderbar zum Denken verführenden Jahrtausendwenden-Poetik.
Denn Goldsmith macht weite Teile seiner Arbeit gut. Gegen die ihm altbacken erscheinende Idee des literarischen Originalgenies feiert er Warhol und Benjamin, Beckett und Satie, Brian Eno und Gertrude Stein. Nicht die schlechteste Wahl, um diversen appropriativen Kunst-Zugängen der klassischen Moderne zu huldigen. Aber es geht um etwas anderes.
Goldsmiths Buch lebt von seinen Beispielen. In Walter Benjamins Passagen-Werk (ein monströses Buch, das aus Hunderten von kopierten Einträgen besteht, die Benjamin mit ellenlangen Fußnoten seiner Gedanken versah) findet Goldsmith ein literarisches Programm für seine Auslegung der Appropriation-Art – einer basalen künstlerischen Methodologie, die bereits vorhandene Kunstwerke nutzt, um diese zu fragmentieren und in neuen Sinnzusammenhängen eines künstlerischen Outputs zu reformieren. Er nutzt Benjamins Gedanken der „Konstellation“ (das Gegenwärtige und das Vergangene reflektieren sich nicht, sondern finden im „Bild“ zu einer Konstellation des „Jetzt“ zusammen), um es auf das Wesen des Internets als Ort diverser Praxen der (Wieder-) Aneignung runter zu brechen. Goldsmith legt uns nahe, Benjamins vielstimmiges Groß-Werk als einen frühen literarischen Vorreiter des Internets zu betrachten. Er baut damit eine der funktionierenden Brücken in seinem Buch, um die Idee eines veränderten Zugangs zur Literatur in einer im Umbruch sich befindenden Spätmoderne auf den Weg zu bringen.
Goldsmith, der lange schon Unreative Writring – Seminare an amerikanischen Hochschulen leitet, ist fasziniert von den partizipatorischen Angeboten, die die im Netz sich tummelnden und sich zu überlagern beginnenden Textmeere machen. Seines Erachtens birgt das Netz alles, was es an Text braucht, um zu „schreiben“. Weil es gefüllt scheint von einer beträchtlichen Masse dessen, was Menschen je geschrieben haben. Er schlägt darum eine Form rezeptiver Wiederaneignung vor, die den Kreativitätsbegriff unserer Bewusstseins-Industrien radikal zu unterlaufen hofft. Eine literarische Ökonomie der gedanklichen Neumischung. Die Konstruktion neuer semantischer und indexikalischer Ordnungs-Systeme. Durch Sampeln, parsen, teilweises Überschreiben, Remixen und upmashen des bereits Existierenden. Kein Wort mehr aus einem je Inneren eines Autoren-Selbst.
Es gibt allerdings einen schwerwiegenden Grund, die relative Erreichbarkeit unkreativer Zustände, wie sie von Goldsmith vorgestellt werden, zu bezweifeln: Der schieren Spezialisierung wegen, derer es bedarf, um auch nur annährend so ambitioniert zu agieren, wie die von Goldsmith als Epigonen einer literarischen Transformation (auf der Grundlage der Elektrifizierung von Information) herangezogenen Christian Bök, Claude Closky, Vanessa Place und andere. Überhaupt ist das Buch gespickt mit Beispielen – eben auch solchen jüngeren Datums – in denen der Vollzug dessen, was Goldsmith in uns kulturell affizieren will, bereits gängige Praxis ist: Sprachliche Appropriation, Aneignung fluiden Sprachmaterials aus dem Netz, aus E-Mails oder aus welcher ursprünglich elektronischen Ressource auch immer, welches in den gewünschten Kontext des Neueigners gestellt wird: Context is the new content!
Doch welcher Art von Sehnsucht sollen die neuen Produzenten von literarischen Werken aus dem Redundanz-Fundus des Netzes eigentlich argumentativ zur Seite springen? Der Sehnsucht nach einer subjektfreien Sehnsuchtslosigkeit, die die Kämpfe um Besonderheit und Singularisierung aufgegeben hat? Wiederholt stellt sich bei der Lektüre von Uncreative Writing der Verdacht ein, dass die Ideen Goldsmiths auf dem Hintergrund allpräsenter Clouds, die die nostalgisch anmutende Löschfunktion früherer Computerzeitalter durch eine vermeintlich unendliche Archivfunktion ersetzt haben, zwar eine neue Variante einer emotions- und expressionsfreien Kunstauffassung bedeuten könnten; mehr aber auch nicht. Goldsmith selbst bringt den aufmerksamen Leser auf die Idee, weil seine Streifzüge durch die Kunstgeschichte, die seinen Argumenten auf die Sprünge helfen sollen, zu dem Effekt geraten, ihn im Handumdrehen ganz schön alt aussehen und viele seiner zeitgenössischen Beispielgeber als zwängliche Inventarisierer, Hobby-Archivare und anderes seltsames Nerd-Völkchen erscheinen zu lassen; anstatt als revolutionäre Erneuerer.
Wir halten fest: Goldsmith will das Biografische aus dem Subjekt verlagern in die Spuren, die es im Netz hinterlässt. Er will einen Biografie-Begriff etablieren, der sich einzig im Abgleich mit den „Handlungen“, die wir online begehen, bestimmen lässt. Damit nähert er sich einer Konzeptualisierung des Biografischen, die den „Menschenbildern“ von Google, Facebook und der NSA näher steht, als ihm lieb sein kann. Sie affirmiert geradezu die Prinzipien unserer brechreizüberfüllten Konsumwarenwelt und ihrer personalisierten Werbe-Strategien. Und sie fällt, was die ästhetische Radikalität des Gedankens an eine Philosophie der Subjektlosigkeit betrifft, sogar noch hinter die Konzepte eines Satie oder Cage zurück, die ein Interesse an der Auslöschung alles Biografischen hatten, ohne eine Restverwertung aus zweiter Hand betreiben zu wollen. Gerade das Beispiel um Saties bahnbrechendes Klavierstück Vexations (Quälereien) von 1893/94 bringt den Widerspruch zwischen manchen der von Goldsmith gewählten Beispiele und den Intentionen seines Uncreative Writing – Programms auf den Punkt: In den Vexations wird eine kurze Piano-Phrase 840 Mal wiederholt, was zu einer Gesamtlänge des Stücks von knapp 20 Stunden und zu einer Art meditativen Ekstase des Pianisten führt. Es handelt sich bei der Kunst Saties um den Versuch, die Musik und den Menschen zu befreien von allem Pressionsdruck, dem er beide in Gestalt eines pompösen Wagnerianismus und impressionistischer Gesten a la Debussy ausgesetzt sah; den Menschen zu befreien mit seiner „Musique d´Ameublement“, die nur Begleitung ohne einen Anspruch auf Beachtung sein wollte. Soweit folgt Goldsmith Satie. Jedoch: Saties Ideal war die „Tabula Rasa“ der Antike, die Reinheit der weißen Tafel eines Unempfundenen. Davon kann bei Goldsmith nicht im Geringsten die Rede sein, dem es nämlich durchaus um starke Empfindungen während des parsens, tweetens und simsens geht. Nicht umsonst blitzt bei Goldsmith das Bild des Junkies auf, der in Höchstgeschwindigkeit seine mentalen Achterbahnfahrten mit der Hochgeschwindigkeits-Datenbahn des Internets zu verknüpfen sucht. Nicht umsonst auch erzählt er uns immer weitere Anekdoten des „leeren“ und dennoch hochemotionalen und narzisstischen Unoriginal-Genies Andy Warhol, zitiert ihn, wo es ihm passend erscheint und zeitigt damit den Ethos des unkreativen Schreibens regelrecht an Warhol geschult.
Goldsmith will also eine neue Sportart in die olympischen Spiele des Narrativen einführen, „eine packende Erzählung, eine psychologische und autobiografische Literatur“ (S. 271) der Daten-Fußabdrücke unserer Netzpräsenz auf den Weg bringen und damit eine technische Transformation des gängigen Höher-Schneller-Weiter. Eine zwiespältige und eigentlich auch wunderbare Idee: Dann nämlich, wenn Goldsmith intendiert, das Subjekt als eine mit einem integren Kern-Selbst ausgestatte Entität endlich auch praxisorientiert zu verabschieden. Nicht umsonst erwähnt er mehrfach zum Ende des Buches die „französischen Theoretiker“, womit er die strukturalistischen Denker und ihre Theoreme anspricht, ohne zu präzisieren. Und obwohl er einen Einstieg in z.B. komplexere radikal-konstruktivistische Theorien vermeidet, vertritt er dennoch die Auffassung, dass das Uncreative Writing auch philosophische Diskurse impliziert.
Doch Goldsmith übersieht zwei immense Schwachstellen seiner Argumentations-Architektur: Zum einen fällt ihm offenbar zu keinem Zeitpunkt auf, dass es absurd ist, ein essentielles Ich als nicht existent anzunehmen, um im gleichen Atemzug kritiklos von Authentizität zu sprechen. Zum anderen wird als letzter Joker der Begriff der Schönheit und der Eleganz angestrengt. Das wirkt, als wolle Goldsmith Maschinenlogik in eine ästhetische Kategorie des Schönen überführen. Schönheit aber ist so nah an die Idee subjekthafter Kreativität und Empfindsamkeit gebunden, dass jene ohne diese gar nicht auskommen kann. Mit solch fundamentalen Widersprüchen erfüllt seine Aufsatzsammlung den Tatbestand einer nicht stringent genug gearbeiteten Anti-Subjekt-Philosophie. Goldsmiths Reformulierung einer poetologischen Ästhetik der „Unoriginalität“ in einem noch immer beginnenden neuen Jahrtausend gerät damit, je länger man ihr folgt, zu einem philosophisch unausgegorenen Cyborg, der einen klaren und oft überraschend kreativen Blick auf die klassische Moderne und einen verklärenden Blick auf ein kultur-utopisches „Terrain Incognito“ unserer Spätmoderne wirft.
Überdies: Wenn Goldsmith im Kapitel Fünf (Warum Appriproation) danach fragt, wie es für jüngere Schriftsteller möglich werden könnte, „in einer gänzlich neuen Art und Weise fortzufahren und zeitgenössische Technologien und neue Distributionswege [zu] benutzen“ (S. 162), möchte man nicht zum ersten Mal während der Lektüre entgegnen, dass sie das aber doch gar nicht müssen. Überhaupt will man öfter unwillkürlich WARUM DENN rufen. Weil sich grundsätzlich die Frage stellt, wieso Goldsmiths richtige Diagnose einer sehr viel früher sehr viel weiter fortgeschrittenen bildenden Kunst dazu führen sollte, eine ähnliche bis gleiche Entwicklung auch der Literatur zu wünschen? Damit diese einen neuen Epochenbegriff erhalten kann etwa, aus kategorialen Zuwachsgründen also? So wunderbar und bisweilen brillant die kunsthistorischen Auslassungen Goldsmiths etwa bei der Darlegung der Rolle von Benjamins Passagen-Werk für die Entwicklung einer literarischen Appropriation-Art auch sein mögen: Aus ihnen eine normative Schlussfolgerung und andere Verbindlichkeits-Ansprüche herzuleiten, mutet verwegen und bisweilen überspannt an.
Danken sollten wir Goldsmith allenthalben dafür, dass er den Diskurs über die Stellung der Dichtung (und damit ist nicht nur die Lyrik gemeint) im Hinblick auf ihre Erneuerungs-Kräfte vorangetrieben hat. Goldsmiths Forderung einer dringend notwendigen Spiegelung der digitalen Revolution (und den durch sie legitimierten Fragen nach Urheberschaft und Notwendigkeit eines Original-Auteurs) muss man dennoch nicht folgen. Von einer Rezeption seines Programms abzuraten und ihm so wenige Leser wie nur möglich zu wünschen, darf indes alsarg unentspannt bis reaktionär eingestuft werden.
Und kommt überhaupt nicht in Frage, denn Kenneth Goldsmiths Buch ist eine sehr unterhaltsame und geistreiche Lektüre; ein Buch, das keineswegs das private Kuriositäten-Kompendium eines verschwenderisch mit Steuergeldern umgehenden Oleander-Forschers ist. Dafür sind die Zusammenführungen loser Argumente-Bündel zu ambitioniert.
Lesen wir Kenneth Goldsmith doch wohlwollend: Wie alle Visionäre (und auch Scharlatane) erklärt er eine am Horizont aufscheinende Transformation als den bereits vollzogenen Ist-Zustand. Das allerdings sagt noch nichts über den zukünftigen Erfolg oder die Dauer der Transformation. Auch nichts über ihre Misserfolgs-Aussichten. Es sagt nur, dass jemand Möglichkeiten früher erkennt und uns Mitteilung davon macht. Allein das macht das Buch für jedes Mitglied kultureller Szenen, welches (nicht nur) im literarischen Diskurs auf der Höhe der Zeit debattieren möchte, zur Pflicht-Lektüre.
Im vorletzten Kapitel (Das Netz als telepathischer Raum) erarbeitet Goldsmith eine Psychologie der digitalen Interaktion, die den körperlosen virtuellen Kommunikationsraum infrage stellt, und das Internet als Erweiterung unseres Zentralnervensystems begreift. Die durchs und im Netz industrialisierte und bis zur Fadheit und Gleichförmigkeit geglättete Sprache ist längst nur noch Provisorium, ihre Instabilität garantiert ihre Leere, ein permanentes „dérive auf der Überholspur, ein rennender Flaneur“, Provisorien der Desorientierung. Goldsmith entlarvt die provisorische Sprache des Netzes als „eine opportunistische Textur aus Eigennutz.“ Und liefert eines der stärksten Argumente: „Wörter bestehen zum Zweck der Zweckentfremdung.“ (S. 317) Grenzenlose Variabilität: Das ist in der Tat das zentrale Wesen lebendiger Sprache. Und damit der Literatur. Bei Goldsmith wird nicht nur Sprache zu Material, sondern auf einer erweiterten Ebene der Aneignung darf und soll auch die bereits bestehende Literatur selbst dazu werden.
Dieses Buch betritt seltsam spät die Bühne des deutschen Buchmarkts. Es wurde in weiten Teilen bereits 2007 geschrieben. In den USA erschien es schon 2011. Das ist bald acht Jahre her, die Texte selbst sind teilweise bereits über 10 Jahre alt. Angesichts solcher Tatsachen mutet das mediale Echo, das die deutsche Ausgabe wirft, fast befremdlich an. Es bestätigt aber auch Goldsmiths leidenschaftliches Pamphlet zumindest in der Hinsicht, keineswegs veraltet oder vergessen zu sein. Im Gegenteil: Wenn Goldsmiths brennende Proklamation Realität wird, steht uns das große Aneignen und Vergessen erst noch bevor.
Stehen zwei Typen an der Ecke. Sagt der eine plötzlich „Pssst, Mann… was is das?“ Der andere spitzt die Ohren und antwortet: „Zwei Goldsmith-UW-PCs, die sich oder uns was vorlesen. Hört aber nie einer zu.“
Kenneth Goldsmith „Uncreative Writing – Sprachmanagement im digitalen Zeitalter“. Erweiterte deutsche Ausgabe. 351 Seiten, EPUB, Hannes Bajohr, Swantje Lichtenstein, erschienen: 2017, ISBN: 978-3-95757-444-2, 25,99 €