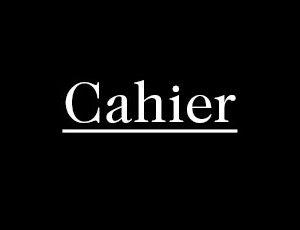Werner Mantz
Oliver Tepel über „Werner Mantz. Architekturen und Menschen“ im Museum Ludwig, Köln, bis 21.1.18
Ich blicke in ein Gesicht schwarz-weiß mit leichter Sepiatönung. Ein Mann, vermutlich am Beginn seines dritten Lebensjahrzehnts sieht mich unvermittelt an, aufmerksam, etwas skeptisch vielleicht, aber offensichtlich sehr selbstbewusst, er beobachtet mich, so scheint es mir. Seine schräg vor die Brust gehaltene Hand hält auf eine etwas dandyhafte Weise eine Zigarette, es ist eine starke Hand, sie könnte sicher gut zuschlagen, wenn sie müsste.
Was sehe ich auf Photos? Gesichter, Häuser, Katzen, Autos, Landschaften, Katastrophen, Gräueltaten. Gelingt mir ein Blick, der vom Gezeigten abstrahiert und die Bilder danach befragt, wie sie inszeniert sind – Perspektive, Blende, Licht und Schatten? Insbesondere bei Photographien, in denen ich einen dokumentarischen Charakter erkenne, misslingt mir die intellektuelle Perspektive. So vertieft sich meine Aufmerksamkeit beim Betrachten von Tata Ronkholz‘ konzeptueller Serie über Trinkhallen der 70er in die Titelblätter der ausliegenden Zeitschriften, den auf einer bedruckten Tafel angebotenen Eissorten und ihren Preis, unwillkürlich bin ich mitten in meiner eigenen Erinnerungswelt. Der Filmtheoretiker James Monaco nannte die große Ähnlichkeit zwischen dem Bild auf der Leinwand und dem, was es darstellt „Kurzschlusszeichen“. Kein Begriff scheint mir geeigneter, die Macht des Unmittelbaren zu fassen, der Impuls des Vertrauten wirkt wie ein Reflex.
Photographiere ich privat selber, prägen auf einmal konzeptuelle Fragen meine Wahrnehmung, nun sind Perspektive, Blende oder Licht und Schatten im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Mein Eindruck aus Gesprächen ist, dass es anderen ähnlich geht. Dennoch fühle ich mich klein und naiv, lausche ich am Ende der Ausstellung „Architekturen und Menschen“ den auf Video verewigten Ausführungen des Photographen Werner Mantz. Tatsächlich sind die Resultate seines oft stundenlangen Wartens auf das richtige Licht und den passenden Himmel sichtbar, gleich architektonischer Elemente wirken manche Schatten, dramatische Wolkenkonstellationen akzentuieren die Dimensionen des Raumes, ja oftmals erscheinen sie als einziger Hinweis darauf, dass die menschenleeren Aufnahmen der geometrischen Eleganz rheinischer moderner Architektur überhaupt eine belebte Welt und nicht ein Modell zeigen. Noch waren leere Straßen möglich, kaum ein Auto parkte irgendwo, Reklameschilder waren nicht allgegenwärtig. Noch, das meint die Zeit zwischen 1922 und 1938, in der Mantz als junger Photograph sich mit distanziert stimmungsvoll ausgeleuchteten, offenbar in einer Atmosphäre aufmerksamer Kontemplation entstandenen Portrait-Photographien beschäftigt. Kein wirklich gutes Geschäft, denn Entwicklung und komplizierte Drucktechniken kosteten Zeit. Dabei war es die Erfahrung, dass er eigene Aufnahmen der überfluteten Kölner Altstadt an Passanten verkaufen konnte, die den halbwüchsigen Mantz eine Karriere als Photograph erwägen ließ. Sein Weg führt nach München, um an der Bayrischen Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie zu studieren und dann wieder nach Köln, wo er sich bald als Photograph der modernen Architektur einen Namen macht und eben mit seinen Portraits, darunter auch das Eingangs erwähnte, es zeigt den Maler Anton Räderscheidt, seine kräftige Hand hielt also einen Pinsel.
In einem anlässlich der Ausstellung geführten und transkribierten Gespräch der Ausstellungskuratorin Miriam Halwani mit Frits Gierstberg vom Nederlands Fotomuseum in Rotterdam nennt der Niederländer das Schlüsselwort: „Individualität“, sie scheint im Zentrum all der Portraits die Werner Mantz anfertigte, selbst dann, wenn er in späteren Jahren, nach Maastricht umgesiedelt, Babys und Kleinkinder ablichtete. Doch vermag „Individualität“ auch schnell zur Chiffre verkommen, wird der Begriff mit der Frage nach dem, was man auf Photos sehen kann, konfrontiert. Individualität, schön und gut, aber welche?
Der Herr mit dem stechenden Blick unter der fast grafischen, wenngleich unterbrochenen Linie, welche die Augenbrauen in sein Gesicht zeichnen, der Stolz in seiner Haltung, der strenge, wahrscheinlich allein durch kleine mimische Bewegungen stumm Herablassung oder Spott verkündende Mund lassen Furcht vor einem 1926 photographierten 50 jährigen Herrn aufkommen. Tatsächlich ist es Ernst Hardt, ein zweifellos scharfsinniger, aber nicht weniger feinsinniger Intellektueller aus dem Umfeld Stefan Georges, Voltaire und Balzac Übersetzer, dessen eigenes Stück „Tantris der Narr“ mit Buchschmuck von Marcus Behmer einem ab und an antiquarisch begegnet. Hardt hatte just auf Adenauers Vorschlag hin die Leitung des neugegründeten WDR (damals noch WERAG) übernommen, doch sah er sich bald im Fadenkreuz der Nationalsozialisten, die ihm seines Postens entheben, ihn kurzzeitig festnehmen und in deren Reichsschrifttumskammer er dennoch bittet, aufgenommen zu werden.
Photographien sind selten dazu gemacht, in die Zukunft zu sehen, doch Hardts beeindruckende Gestalt auf dem Portrait von 1926 lässt in Unkenntnis seiner Person an einen Firmenchefs, einen strengen Lenker schließen. Was sehe ich auf einem Photo? Wenn ich Individualität im Abbild eines Menschens erkenne, so mag diese Wahrnehmung in Wirklichkeit die Anregung bedeuten, über das Leben der dargestellten Person zu spekulieren, über ihre Vorlieben und Eigenheiten und dabei das aus eigener Erfahrung angesammelte Vermuten über Ausdruck und dessen Bedeutung anzuwenden, das eigene Urteil, welches stets als Gefahr in sich birgt, zu viel in einem Antlitz erkennen zu wollen. Tatsächlich aber blüht aus nahezu jedem von Mantz’ Portraits diese, vielleicht am besten „erzählerisch“ zu nennende Qualität und ja, anders als der Archetypen gestaltende Sander, vermochte Mantz’ Photokunst einen viel weiteren, unbestimmten Raum zu öffnen. Da ist die Schauspielerin Olga Reinecke, ihre von einem schwarzen Schatten umfangenen Augen lassen an Schwindsucht oder Opium denken, währen ihre zarten Mundwinkel ein Drama verkünden wollen, wie man es sich für eine Schauspielerin des 19. Jahrhunders imaginisieren mag. Oder Bilder von Schulkindern kurz vor dem zweiten Weltkrieg, sie werden durch ihre Eingebundenheit in die Zeitgeschichte zu Abbildern der Frage nach dem Leben dieser Menschen, hier löst die Geschichte die Wirkung des Bildes von allem, in ihm angelegten Ausdruck.
Halt! Ist der Ausdruck denn angelegt? Frits Gierstberg erwähnt im Interview, was der Besucher längst unmittelbar erfahren haben mag: jedes Portrait weist in seiner Gestaltung über seine formalen Qualitäten hinaus, keine Massenware, sondern ein Gefühl für Situationen und wohl auch für das Gegenüber sind so offensichtlich, dass sich die Besucher tatsächlich aufmerksam den einzelnen, in thematischen Gruppen sortiert gezeigten Bildern widmen. Gleichzeitig suggerieren die Begleittexte ein Problem, welchem dem Betrachter vielleicht gar nicht gewahr wird: Mantz’ Werke waren Auftragsarbeiten und er selber sah sich nicht als Künstler. Was also führt sein Schaffen in ein Kunstmuseum? „Die Qualität“, sollte als Antwort reichen, doch im erwähnten Gespräch hadert Kuratorin Miriam Halwani mit dem Künstlerbegriff und führt dabei ihre Profession, die Kunstgeschichte an. Doch hat diese nicht in großem Maße mit Auftragskunst zu tun? Ist Fra Angelico nicht Künstler zu nennen, weil seine Arbeiten angefordert wurden? Eine sich mit einem ungeklärten Freiheitsbegriff belastende Definition des Künstlers scheint immer noch für einen Wust an Problemen in einer Wissenschaft zu sorgen, die sich so gern der Akkuratesse verschreibt aber letztlich doch beim wertenden Urteil landet. Die zahlreichen Besucher der Ausstellung, welche ich beobachtete, nahmen Werner Mantz‘ Bilder als einen Teil des Angebots des Museum Ludwig wahr, niemand verließ sie kopfschüttelnd, eher schien mir, die Besucher blieben länger als sie es für sich eingeplant hatten. Vielleicht ist ja Kunst, was als Kunst angesehen wird.
Zugegeben, die Faszination resultiert nicht nur aus der tatsächlich beeindruckenden Wirkung der Bilder mal scheuer, dann wieder scheinbar verzückter Heiligenbildchen nachstellenden Kommunionsemfpängerinnen oder durch die Aufnahmen meist leerer holländischer Landstraßen und ihrem jahreszeitlichen Bewuchs, die so konzeptuell wirken, dass es doch eigentlich egal ist, ob sie als freie Kunst oder Verwaltungsauftrag erstanden (die möglichen künstlerischen Konzepte können sich die Besucher sicher selbst imaginieren). Nein, es sind die vielen Bilder des modernen Vorkriegskölns mit oftmals verschwundenen, beeindruckenden Neubauten, welche nicht wenige Besucher bannen. Wo steht das Haus? Einiges ist einem bekannt, vieles war eh vermerkt, aber bereits bei einer Ausstellung im Ludwig anno 1982 blieben einige Gebäude ungeklärt, so dass die Besucher aufgefordert wurden, Informationen beizusteuern. Eine Vitrine gibt Auskunft über die zahlreichen und offenbar enorm hilfreichen Auskünfte der Besucher. Manche der Gebäude sind aber bis heute nicht zu bestimmen, andere werden nicht ganz korrekt benannt. Etwa das „Israelitische Kinderheim“, bei dem es sich tatsächlich um die jüdische Kindertagesstätte handelt, welche auch nicht wie angegeben von Clemens Klotz (der als Architekt der Nationalsozialisten Karriere machte), sondern vom jüdischen Architekten Georg Falck entworfen wurde, wie es Wolfram Hagspiel in seinem Buch „Köln und seine jüdischen Architekten“ auflistet. Falck überlebte den Krieg in Verstecken in Holland um 1947 in die USA ausreisen zu können, wo er wenigen Wochen nach der Ankunft starb. Entgegen seiner üblichen Praxis hatte Werner Mantz 1930 vor der just fertiggestellten Tagesstätte eine Gruppe Kinder aufgenommen. Eine Idylle vor diesem einladenden, elegant geschwungenen Bau und ein Entsetzen, ob der Schicksals dieser jungen Menschen. Was zeigt ein Photo?